Erinnerungen eines Auslandschweizers an sonnige Bergfahrten
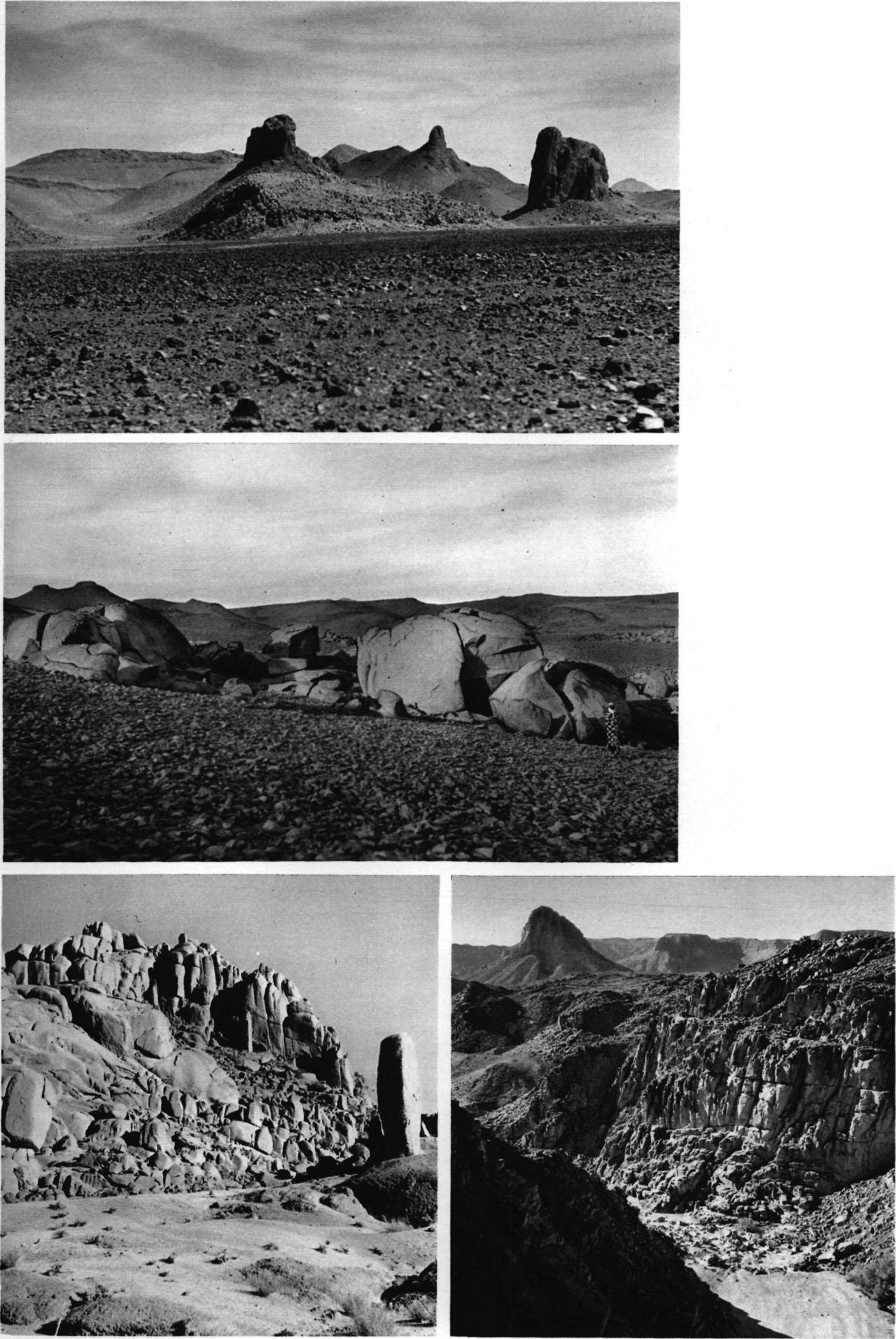
JVon W. Stettbacher
Mit 2 Bildern ( 66, 67Beckenham, Kent ) Auffallend früh erwachte in mir die Liebe zu den Bergen; der Drang nach der Höhe war in mir so stark, dass ich wohl zu jeder Zeit, selbst im hoch-gebirgsfeindlichen Mittelalter, als Alleingänger zu den Gletschern und Schneegipfeln vorgedrungen wäre. Schon als Primarschüler unternahm ich kleinere Bergtouren und Fusswanderungen im Glarner- und Urnerland. Mit 12 Jahren bestieg ich den Urirotstock allein, und drei Jahre später wagte ich mich mit meinem Bruder an den Tödi heran. Sobald ich als Kantonsschüler die Zürcher Zentralbibliothek benutzen durfte, « verschlang » ich mit grosser Begierde die gesamte dort aufbewahrte Bergliteratur; Bücher von Guido Rey, Mummery, Zsigmondy und Whymper kannte ich fast auswendig. Es verwundert daher nicht, dass ich schon als 18jähriger Kantonsschüler Mitglied der Sektion Uto wurde.
Kurz nachher begab ich mich zur Vervollkommnung in der englischen Sprache nach England, und da es das Schicksal bestimmte, dass ich mich dort dauernd niederliess, wurde mein Wunsch, ein eifriges, rühriges Sektionsmitglied zu werden, natürlich vereitelt. Meine Leidenschaft für die Berge wurde aber dadurch eher noch gesteigert, und meine Sommerferien dienten stets dazu, Viertausendern auf den Leib zu gehen.
Im Gegensatz zu der heutigen, jüngeren Generation, die im Bergsteigen mehr dem Sport, der Körper- und Muskelleistung huldigt und gewissermassen im Rekord das Endziel erblickt, habe ich mich kaum weniger den Stimmungen hingegeben, welche die Landschaft im Wechsel der Tagesbeleuchtung und der vertikalen Klimaveränderung den offenen Sinnen darbietet. Unvergesslich bleibt mir die dramatische Aussicht vom Weisshorn, wo die glänzenden Spitzen, umtanzt von seidenen Silberwölklein, gespenstisch aus den dunkeln Tälern in den Föhnhimmel starrten, oder vom Nadelhorn, wo — nach kurzer Regenperiode — die Durchsichtigkeit der Luft visionäre Formen annahm und den Blick in ungeschaute Fernen schweifen liess.
Schon früh ging ich darauf aus, als Auslandsschweizer meine wenigen Ferienwochen dem Alpinismus zu widmen und mit Führern das Maximum an Hochtouren zu leisten. Einige Versuche in den zwanziger Jahren, von England aus passende Begleiter zu finden, waren unbefriedigend. Einmal Schloss ich mich einem Mathematikprofessor an, der die Besteigung eines der leichtesten Viertausender, des Allalinhorns, vorhatte. Ehe er sich zum Überspringen einer Gletscherspalte entscheiden konnte, wurde deren Breite mathematisch errechnet; ergab sich nicht mehr als 80 cm, so wurde sie nach längeren Vorbereitungen übersprungen; Spalten von einem Meter mussten jedoch umgangen werden, da er seine Frau und Kinder nicht aufs Spiel setzen dürfe. Bei der Abrechnung unserer Kosten spaltete er wieder die Rappen mit einer Präzision, die den Mathematiker als Familienhaushalter ins beste Licht setzte. Kaum hatte ich diesen Professoren abgehängt, als sich mir ein Student aufdrängte. Trotz seiner gegenteiligen Behauptung erwies er sich ganz berguntüchtig, und mit viel Mühe und Gefahr brachte ich ihn über den Allalinpass. Auf der Täschalp war ich froh, ihn loszuwerden, nicht ohne dass er noch meinen Kochapparat geborgt hätte, den ich natürlich nie wieder zu sehen bekam. In der Folge schrieb mir mein Vater, dass ein bekannter Zürcher Rechtsanwalt mich im Sommer 1924 begleiten möchte; er sei eine wahre Bergkanone. Wir sollten nach einer Trainingstour den Dom und andere bekannte Walliser Berge besteigen. Meine erste Überraschung kam beim Zusammentreffen im Bahnhof Zürich, indem der Anwalt von einem 76jährigen Herrn begleitet war. Dieser « alte Mann » entpuppte sich als ein früherer Guts-verwalter im zaristischen Russland. Bei unserer Trainingstour von Stalden auf den Augstbordpass erwies sich der « Senior » als der weitaus schnellste von uns; er galoppierte ständig davon und war kaum je zu sehen. Der Anwalt-— die vermeintliche Bergkanone — versagte jedoch vollständig. Er kam fast nicht vom Fleck, und es bedurfte viel Energie meinerseits, ihn so anzuspornen, dass wir eine Nacht im Freien vermeiden konnten. Auch er berief sich auf seine Frau und Kinder, derentwegen er äusserst vorsichtig sein müsse. Als wir den Dom besteigen wollten, argwöhnten die beiden plötzlich einen baldigen Wetterumschlag. Diese meteorologisch merkwürdige Übereinstimmung war aber nicht durch den drohenden Himmel, sondern durch den drückenden Geldmangel angesichts der Bestellung eines Führers verursacht. Ich wurde die beiden bald los, und bestieg folgendentags bei strahlendem Wetter den Dom.
Auch nahm ich an einigen Sektions- und besonders längeren Sommertouren teil. Es zeigte sich jedoch bald, dass diese mir nicht ermöglichten, meine Ferien voll auszunützen und so viel zu leisten wie mit Führern. Die Teilnehmer an solchen Touren waren nicht immer gleich geübt, so dass die Programme oft nicht voll zu Ende gebracht werden konnten; ausserdem passierte es mir in zwei Fällen, dass die leitenden Führer ortsunkundig waren und uns regelrecht irreführten.
Mit Bergführern habe ich alle geplanten Touren, mit einer Ausnahme, ausgeführt. Sie kannten eben durchweg die Anstiegsrouten in ihrem eigenen Gebiet. Ich bin allerdings immer von gutem Wetter begünstigt gewesen und habe nur ganz selten tatenlos mit Jassern und Tabakqualmern in Klubhütten « hospitieren » müssen.
In den zwanziger Jahren litt ich in den ersten Tagen nach meiner Ankunft in den Bergen bisweilen an Magenbeschwerden und sogar an Bergkrankheit, wohl bedingt durch den Luft- und Klimawechsel sowie mangelndes Training. Es ist nicht jedermanns Sache, direkt vom ozeanischen England herkommend, Viertausender anzupacken. Ich lernte jedoch bald, Nahrung und Getränk den veränderten Bedürfnissen anzupassen und zudem die Touren mit voll trainiertem Körper zu beginnen; Schwimmsport das ganze Jahr hindurch, Eilmärsche und Velofahrten in raschem Tempo über grosse Distanzen führen zu einer Kondition, die mich ohne Höhenanpassung gleich zu schwierigen Besteigungen befähigte.
Anfangs August 1933 unterhielt ich mich mit einer Führergruppe in der Hauptstrasse in Zermatt. Nebenbei stand ein grosser, aristokratisch aussehender Mann, dessen Gesicht mir etwas bekannt erschien. Er trug kein Führerabzeichen, und ich hielt ihn für einen Zermatter Gemeinderat oder sonst eine Walliser Persönlichkeit. Einer der Führer nach dem andern begab sich zum Mittagessen nach Hause, nur dieser schlanke Mann mit den feinen Gesichtszügen blieb zurück und liess sich mit mir in ein Gespräch ein. Ich wurde bald gewahr, dass er alles über die Berge zu wissen schien, so dass ich mehr und mehr wunderte, wer er sein könnte. Es war Franz Lochmatter, der unvergessliche Bergführer von St. Niklaus. Einige Wochen später konnte ich es kaum fassen, dass sein sonst so unfehlbarer Fuss am Weisshorn ausglitt.
Unter den Besteigungen, die mir besonders im Gedächtnis blieben, ist mein erster Viertausender im Jahre 1923, das Zermatter Breithorn, das ich im Alter von 20 Jahren mit dem den altern Bergsteigern wohl noch bekannten Führer Ludwig Truffer bestieg. Im darauffolgenden Jahr setzte ich meinen Fuss auf den Dom, den höchsten gänzlich auf Schweizer Boden stehenden Berg. Im Jahr 1927 stand ich mit meinem neuen, langjährigen Führer Gabriel Perren, aus Zermatt, auf dem Monte Rosa. Ich erinnere mich noch an einen Vorturner aus Winterthur, der am nächsten Morgen seinen ihn begleitenden Turnern davon rennen wollte. Auf ca. 4000 Meter Höhe erging es ihm gleich wie Winston Churchill, der 20. Jahre früher an der gleichen Stelle von der Bergkrankheit befallen wurde. Der Unterschied war nur der, dass der Oberturner mit seiner Schar allerlei Ausflüchte hatte, während Churchill ein für allemal zum Schluss kam, dass er eben zum Bergsteigen nicht tauge. Im Jahre 1929 wagte ich mich an das Matterhorn heran. Ich kam direkt von London nach Zermatt, wenig trainiert. Am Vortage hatte es tüchtig geschneit, und als mein Führer andere fragte, was sie von einer Besteigung des Hornes hielten, antwortete einer: « Du bisch-es Chind. » Dies hinderte jedoch nicht, dass am nächsten Tag ca. 20 Partien auf der Spitze anlangten. An den letzten Seilen vor dem Dach fühlte ich die Höhenluft und hatte eine Schwäche, aber die Flasche Milch, die ich — statt Coramin oder sonstiges Doping — immer bei solchen Touren mitführe, verhalf mir auf den Gipfel. Gleichzeitig langte eine amerikanische Familie: Vater, Mutter, Sohn und Tochter, jede Person mit einem Führer eine Seilschaft bildend, auf dem Gipfel an. Niemand von dieser Familie soll vorher in den Bergen gewesen sein.
Schon im Jahre 1928 hatte ich mit dem « Rasiermesser » der Sphinx und den Bosses auf dem Zinal-Rothorn Bekanntschaft gemacht und dies natürlich als eine « zünftige » Tour betrachtet. Eine der schönsten Touren überhaupt führte über die Wellenkuppe aufs Obergabelhorn mit Abstieg über den Arbengrat. 1932 wurde ich einige hundert Meter unter dem Gipfel der Dent Blanche wegen schlechten Wetters zum Rückzug gezwungen, die einzige mit Führer fehlgeschlagene Tour. 1937 erklomm ich als erster in jenem Sommer das Weisshorn über die gewöhnliche Route, vielleicht der schönste von mir bestiegene Berg.
Im Jahre 1938 stand ich auf dem höchsten Gipfel Europas, dem Mont Blanc. Im Abstieg begegneten wir bei der Cabane Vallot gegen 100 französischen Chasseurs Alpins, die — vorwiegend aus Bergführern und Ski-champions zusammengesetzt — der ganzen Welt zeigen sollten, dass nicht nur italienische Soldaten zu einer Besteigung des Mont Blanc fähig sind. Ein Teil der Soldaten litt jedoch schwer unter der Höhenluft und an Bergkrankheit und musste zurückbleiben.
Einige Wochen vor Kriegsausbruch, nach vorhergehender Besteigung des Kastor und Pollux, Schloss ich mich der Sektion Uto für die Besteigung des Flälschhorns vom Simplonpass aus an. Unserer Führer war jedoch des Weges nicht ganz kundig, und erst nach 15stündigem Umherirren auf Graten und Gletschern, zum Teil in dichtem Nebel, gelang es uns, die Weissmieshütte zu finden.
Die Erkletterung des Nordgrates des Weissmies mit der Sektion Uto im Sommer 1946 werde ich nicht so leicht vergessen, da die schwere Tour kaum für einen grösseren Seilverband geeignet ist. Bei der berüchtigen grossen Platte wurde ich — nolens volens — zum erstenmal mit der « Mehlsacktechnik » vertraut gemacht.
Wenn ich nach einem Abstand von 10 oder 20 Jahren einen Viertausender zum zweitenmal besteige, frage ich mich immer, ob es gegen früher besser gegangen sei oder umgekehrt. Bis jetzt habe ich die angenehme Erfahrung machen können, dass die ersten Besteigungen mir mehr Mühe kosteten. So z.B. bedurfte es 1929 einer letzten Kraftanstrengung, meinen Fuss auf das Matterhorn zu setzen; 17 Jahre später kam mir die gleiche Sache fast wie ein Spaziergang vor. Bei der erstmaligen Besteigung des Monte Rosa im Jahre 1927 hatte ich stark an der Höhenluft zu leiden; 21 Jahre später verlief alles ganz gut.
Vom Nachtflug aus London eingetroffen, verliess ich Zürich gleich mit dem frühen Genfer Schnellzug, um von Lausanne aus nach Martigny weiterzufahren. Im gleichen Coupé sassen einige Alpenklubmitglieder, die sich auf eine Tourenwoche begaben. Ihr Augenmerk richtete sich sofort auf mein brandneues Veteranenabzeichen, das ich erstmals trug, obwohl ich seit vier Jahren Veteran war. Der mir gegenübersitzende Mann deutete schliesslich auf mein Abzeichen und erklärte mit ernster Miene: « Ich sehe, dass Sie bereits Veteran sind, Sie gehen also dem Alter entgegen, Sie werden jetzt wohl keine hohen Berge mehr besteigen, sondern sich mit kleineren Sachen begnügen. » Welch ein Pessimist, dachte ich mir und wechselte nächstes Jahr das Veteranenabzeichen gegen das gewöhnliche.
Nach diesem kurzen, nicht ermutigenden Dialog sagte ich mir, vielleicht hast du mehr Glück mit den neben dir sitzenden jungen und hübschen Damen. Es waren zwei in Solothurn ansässige und sich nach Champex in die Ferien begebende Bernerinnen, mit denen ich in ein köstliches Gespräch kam.
Die eine zeigte sich als leidenschaftliche Leserin der « Alpen », während der anderen Mitglieder des SAC besondere » Respekt einflössten, weil sie so seriös seien. Meine Bemerkung, dass es auch unter uns durstige Seelen gäbe und dass ich in einer Hütte unlängst einer 20 Mann starken Sektion begegnet sei, die eine geplante Besteigung wegen zu reichlichen Genusses von « Roter Milch » nicht antreten konnte, kam ihr daher offensichtlich etwas überraschend.
In Orsières wartete mein Führer Robert Baileys aus Bourg-St-Pierre bereits auf mich, und wir bestiegen das Postauto nach La Fouly. Unser erstes Ziel war der Tour Noir. Schon beim Weggang war das Wetter gewitterhaft, langsam fing es an zu regnen, und bei unserer Ankunft in Fouly goss es in Strömen. Wir stärkten uns in einem Restaurant und warteten auf eine Aufhellung. Obwohl hie und da etwas blauer Himmel hervorguckte, liess der Regen nicht nach, und ich fragte mich bereits in Gedanken, ob mein bisher sprichwörtliches Wetterglück nun doch zu Ende sei. Um 5 Uhr abends brachen wir dennoch zur Neuvazhütte auf. Halbwegs liess der Regen endlich nach, um etwas unter der Hütte verdoppelt auf uns herunterzuprasseln. Nach zwei Stunden zwanzig Minuten langten wir in der Hütte an. Obwohl mein neuer ölanzug völligen Schutz gegen Regen bot, war ich durch Schwitzen doch total durchnässt. Wir waren allein in der Hütte und hatten -alle Musse, uns auf die kommende Tour vorzubereiten. Ein dichter Nebel, der frühmorgens die Hütte einhüllte, verhinderte uns jedoch an einem frühen Aufbruch. Allein gegen 9 Uhr durchbrach die Sonne die Nebelwand, löste das graue Element zusehends auf und bescherte uns unerwartet einen Prachtstag. Wir verliessen die Hütte genau um 9 Uhr und erreichten den Gipfel mühelos nach genau fünf Stunden. Der Anstieg erinnerte mich an den Hörnligrat am Matterhorn. Wir wurden durch eine grandiose Aussicht reichlich belohnt, und ich kam beim Photographieren voll auf meine Rechnung.
Wir übernachteten wieder in der Neuvaz- ( oder Dufour-)hätte, um am Morgen früh ins Tal abzusteigen und mit dem ersten Postauto nach Orsières zu fahren. Ich benutzte diesen Tag, der wieder von glänzendem Wetter begünstigt war, zu einem Abstecher nach Champex, um mir diesen so viel gerühmten Ferienort näher anzusehen und auch einen neuen Film zu be- schaffen. Nach meinen beiden Hüttennächten sehnte ich mich nach einem Bad. Bei der Badanstalt am See begegnete ich wieder den beiden Bernerinnen, mit denen ich von Lausanne reiste; sie mieteten ein Boot, während ich den See in beiden Richtungen durchschwamm.
Am nächsten Tag, nach einem ausgezeichneten Mittagessen im Restaurant « Napoleon » in Bourg-St-Pierre, machte ich mich mit meinem Führer auf den Weg zur Valsoreyhütte, wo er Hüttenwart ist, mit der Absicht, den Grand Combin zu überschreiten. Wir hatten voriges Jahr diesen Berg bereits bezwungen, waren aber auf gleicher Route hinuntergestiegen. Diesmal wollte ich den Grand Combin nach Pannossière überschreiten, um im Abstieg Aufnahmen von der « Mur de la Côte » und beim « Corridor » zu machen. Das Wetter war nicht vielversprechend, und schon verspürten wir einige Tropfen. Auf dem « Chalet d' Amont » stärkten und verproviantierten wir uns mit Milch. Einer der beiden Käser — einer der wenigen deutschsprachigen Italiener aus dem Gressoney — mit seinem Bart und bildschönen Antlitz mehr wie ein Künstler oder Maler aussehend, erinnerte sich sofort an unsere Begegnung vom vorigen Jahr.
Auf der Hütte begrüsste uns die 15jährige Führerstochter, die uns mit einem flotten Abendessen aufwartete und ihr perfektes Hochdeutsch, das sie in einer Zuger Schule gelernt hatte, zum besten gab.
Der Abend war wenig verheissungsvoll, aber bei der Tagwacht schimmerten die Sterne, wenn auch die Wärme und die um den Mont Blanc herumhängenden Wolken wenig Vertrauen einflössten. Ausser einigen vereisten Felsen, die grösste Vorsicht erheischten, bot der Aufstieg über den Westgrat zum Combin de Valsorey keine besonderen Schwierigkeiten. Überall am Horizont lagen jetzt schwarze, schwere Wolken, die nichts Gutes vorausahnen liessen. Mein Führer war trotzdem noch optimistisch. Wir stiegen nun in aller Eile auf die noch im Sonnenlicht erglühende Schneepyramide des Grand Combin. Im Moment des Betretens des Hauptgipfels waren wir von dichten Schneeschwaden umringt, und ohne Warnung brach eine richtige Hölle mit Donner, Blitz und Schneesturm los. Kein Zweifel: hier befand ich mich in einem wahren Schneesturm, der in der Geschichte des Alpinismus so oft Tragödien verursacht hat, und ich musste an die beiden Italiener denken, die hier vor einer Woche unter ähnlichen Verhältnissen ihr Leben verloren. Wir machten uns sofort an den Abstieg zur ferngelegenen Cabane de Pannossière. Im jede Sicht raubenden Schneesturm schlug mein Führer, der trotz der auf einige Meter beschränkten Sicht die Abstiegsroute offenbar genau kannte, Stufe um Stufe, die nach wenigen Sekunden vom Schnee bereits wieder aufgefüllt waren. Wir befanden uns in der gefürchteten « Mur de la Côte », einer Eiswand mit stellenweise 70 Grad Neigung. Es schien eine Ewigkeit zu dauern, bis wir endlich aus ihr hinauskamen, und wir kamen sicherlich nur wegen der guten Ortskenntnis des Führers heil davon. Drei Stunden lang heulte, blitzte und schneite es, und stellenweise lag 20 cm Neuschnee. Beim « Corridor » war die grösste Gefahr hinter uns, es hellte wieder langsam auf, und beruhigt blickten wir zu den gigantisch überhängenden Gletscherabbrüchen empor, die ihre Eismassen von Zeit zu Zeit in den « Corridor » hinabsenden.
Am nächsten Tag begab ich mich über Ferret und den Grand Col Ferret zum Refuge Elena, um die Grandes Jorasses über die gewöhnliche Route anzugreifen.
Im Refuge wurde ich vom Besitzer aufs freundlichste empfangen, ebenso von der Grenzpolizei, im Gegensatz zu 10 Jahren vorher, wo ich gerade vor Kriegsausbruch einem längeren Verhör unterzogen wurde.
Das Wetter hatte sich wieder verschlechtert, und auch der folgende Morgen war nicht verheissungsvoll. In Entrèves, dem Ort der grössten Höhen-gegensätze in den Alpen, hatte ich Rendezvous mit meinem letztjährigen Führer abgemacht. Nach einem ausgezeichneten Mittagessen machten wir uns an den Aufstieg zur Hütte der Grandes Jorasses. Einen steileren, schwierigeren und unangenehmeren Hüttenweg könnte ich mir kaum vorstellen, aber dafür wird man die ganze Zeit durch eine wundervolle Fernsicht entschädigt.
Wir waren wieder allein, und ich konnte gut schlafen. Als wir morgens 3 Uhr aufbrachen, schien alles auf einen seltenen Glanztag zu deuten. Wir schnallten uns bald die zu diesem Unternehmen nötigen Steigeisen an, deren wir uns erst neun Stunden später wieder entledigen sollten. Steile Gletscher wechselten beständig mit Fels, und es lohnte sich nicht, sie beim Fels auszuziehen. Ungefähr halbwegs kamen wir zu einem steilen, von Steinschlag bedrohten Eiscouloir, wo grosse Stufen gehauen werden mussten und das besonders im Abstieg grosse Vorsicht erheischte. Es folgte dann ein ca. 30 Meter hohes, fast senkrechtes Kamin, das mir anfänglich wenig ver-trauerweckend erschien, sich aber schliesslich ziemlich leicht bewältigen liess.
Wir betraten nach genau sechs Stunden harter Arbeit den Gipfel, und die Aussicht entsprach mehr als meinen Erwartungen. Der Gipfel hatte etwas Wächten, die die Aussicht auf die berüchtigte Nordwand und den schaurigen Hirondellesgrat verdeckten.
Noch am gleichen Abend marschierte ich zum rund 15 km weiter oben im stillen Ferrettal gelegene Refuge Elena, um am nächsten Morgen früh über den kleinen Col Ferret ( Pas de Grapillon ) auf Heimatboden zurückzukehren.
Während der Kriegsjahre war ich verhindert, meine Sommerferien in der Schweiz zu verbringen. Ich wurde jedoch dafür gewissermassen durch meinen Aufenthalt in Schottland entschädigt. Ende 1940, als London direkt in die Frontlinie kam, verlegte ich mein Domizil nach Schottland, wo ich während vier Jahren wohl die schönste und glücklichste Zeit meines Lebens verbrachte. Ich begab mich nach Schottland mit einer Reihe von Vorurteilen; nach den Aussagen der meisten Südengländer hätte ich geglaubt, mich in ein unzivilisiertes Land, wenn nicht in eine Art von Wüste, mit dem unmöglichsten Klima zu begeben. In Wirklichkeit sah es ganz anders aus. Ich lernte die Schotten bald als die angenehmsten und freundlichsten Leute kennen, eines der wenigen Länder mit wahrer Demokratie, wo man nicht nach seiner Schulbildung und Akzent ( wie in England ) oder nach seinem Geldbeutel beurteilt wird, wo aber vor allem der Charakter eines Menschen massgebend ist, gleichgültig, ob man Strassenwischer, Landarbeiter oder Wohlhabender ist. Von der sprichwörtlichen schottischen Gastfreundschaft gar nicht zu reden!
Während vier Jahren hatte ich reichlich Gelegenheit, das schottische Hügel- und Bergland zu durchstreifen, per Velo und zu Fuss, und im Verlaufe meiner Wanderungen habe ich Berge erklommen und Landschaften gesehen, die mich in vielfacher Hinsicht an Schweizer Alpen in der Höhenlage von 1500-2500 Meter oder an Berge wie Speer und Säntis erinnern. Im Nordwesten Schottlands hat es Berge, die Gelegenheit zu schwierigen Klettereien bieten, von deren Schwere die zahlreichen alljährlichen Opfer Zeugnis ablegen. Obwohl die meisten der bekannten Berge in militärischen ( verbotenen ) Zonen lagen, war es mir auf Grund spezieller Bewilligungen doch möglich, die zwei wohl bekanntesten schottischen Berge, den Ben Nevis und Ben Lomond, mehrere Male zu besteigen. Der Ben Lomond, ca. 958 Meter über dem Meer, liegt nur ca. 50 km nordwestlich von Glasgow und ist relativ leicht zu erreichen; der höchste Berg Schottlands und Grossbritanniens überhaupt, der Ben Nevis ( 1343 Meter ) liegt abseits, ebenfalls im NW, ist aber schwieriger zu erreichen. In dieser Region gibt es fast das ganze Jahr hindurch Regen und Nebel, und glücklich kann sich der schätzen, der den Gipfel des Ben Nevis bei schönem Wetter erreicht. Bei meiner ersten Besteigung dieses Berges wurde ich durch eine unvergleichliche Fernsicht belohnt. Die steil nach Norden abfallenden Felswände erfordern eine schwierige Kletterei. Obwohl Mitte Juli, hatte es auf dem Gipfel des Ben Nevis, der mich an den Säntis erinnert, noch Schnee, und die Überreste der früheren Wetterwarte waren noch deutlich sichtbar. Wie das Wetter hier unbeständig ist, geht schon daraus hervor, dass, obwohl ich meinen Abstieg noch bei schönstem Wetter begann, es nach einer halben Stunde bereits nebelte und regnete.
Was mir vor allem an den schottischen Bergen und Tälern gefällt, ist ihre Einsamheit und Unverdorbenheit. Man bekommt den Eindruck, dass Landschaft und Leute genau so aussehen wie vor einigen hundert Jahren. Es kommen in diese Berge noch keine Scharen von Touristen...