Sinabum, der heilige Berg der Karolanden in Nordsumatra
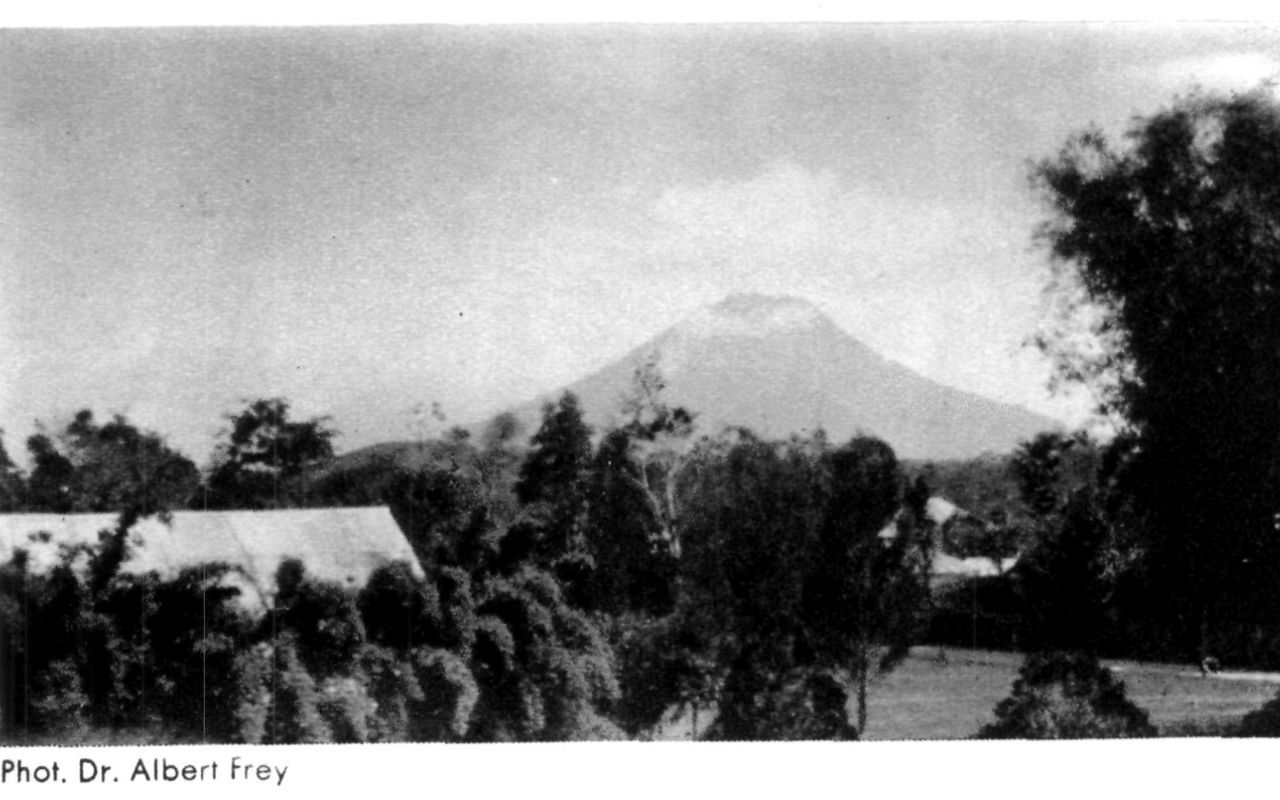
Zwischen den beiden Randgebirgsketten, die Sumatras Ost- und Westküste folgen, liegt die Hochebene der Batakländer, 1000 m ü. M. Diese birgt zwei heimwehstillende Kleinode: den Tobasee, der sich etwa viermal so gross wie der Bodensee mit oberitalienischen Steilufern und engadinischer Bläue ausdehnt, und etwa 50 km nordnordwestlich davon den heiligen Berg Sinabun. Als idealer vulkanischer Kegel erhebt er sich dem Fushiyama ähnlich hoch über die steppenartige Ebene.
An den Alpen gemessen, ist er mit seinen 2451 m ein Zwerg. Aber in den Tropen, wo das Bergsteigen ein seltener und oft nur durch Organisation von kostspieligen Expeditionen erreichbarer Genuss ist 1 ), zieht einen seine sanft gen Himmel steigende Pyramide magnetisch an. Die meisten Gipfel der Randgebirge sind mit Urwald bedeckt, so dass man oben nach all dem Kampf mit der Vegetation nur spärliche Aussicht geniesst. Aber auf dem Sinabun wird die Gipfelvegetation durch die vulkanischen Dämpfe niedergezwungen, so dass einem ein unvergleichliches Panorama wartet. Bei klarem Wetter soll man sogar über die beiden Randketten hinweg im Osten die Strasse von Malakka und im Westen den Indischen Ozean sehen.
Das Auto bringt meinen holländischen Begleiter und mich von unserem Standquartier Kaban Djahé ( 81 Wegkilometer von Medan, dem Hauptort von Sumatras Ostküste ) über drei tief eingeschnittene, kanonartige Schluchttäler nach dem Batakerdorfe Guru Kinajan, 1060 m, an der Südseite des Sinabun. Guru heisst in den malaiischen Sprachen « Schreibkundiger », und Kinajan war der Name eines berühmten Gelehrten, nach dem das Dorf benannt wurde. Auf bis fünf Meter langen Streifen von Baumrinden hat der « tempo d' hulu»seiner Zeit ) seine Weisheit mit der Bataker Runenschrift aufgezeichnet, so erzählt unser Führer Massik. Er ist ein junger, feuriger Bataker und gewohnter Berggänger, mit dem wir vor einer Woche auf einem Ausfluge nach dem auf der Nordseite des Sinabun gelegenen Urwaldbergsee Lao Kawar Bekanntschaft gemacht haben. Er wirbt im Dorfe zwei Träger an; einer trägt das Essen, der andere meinen Rucksack mit meiner Gebirgsausrüstung, der Führer selbst unsere Wolldecken; womöglich alles auf dem Kopfe, nach angestammter Batakart.
Vor 20 Jahren noch war zur Besteigung des Sinabun eine ganze Expedition notwendig 2 ). Damals zahlreiche Kulis, um einen Weg durch den Urwald zu bahnen, Wasserträger, die in riesigen Bambusrohren das wichtige Getränk mitschleppten, Biwakzelt usw. Heute aber führt von Guru Kinajan ein Weg hinauf, der vom topographischen Dienst angelegt worden ist; zugleich dient er auch dem meteorologischen Dienste, dem Forstwesen und den Eingebornen als — Wallfahrtspfad. Unter dem Gipfel ist sogar eine Schutzhütte angelegt worden, da wollen wir übernachten.
In der heissen Nachmittagssonne ziehen wir auf schwankendem Bambus-steg über ein eingeschnittenes Trockenbett aus dem Dorfe dem Berge entgegen. Die Karawane besteht aus zwei Europäern und drei Batakern. Zuerst steigen wir über alpenartige Weiden hinan, auf denen sich grosse Herden der plumpen Karbauenindische Wasserbüffel ) tummeln. Es ist fast unglaublich, wie spielend die Hirtenjungen diese kraftstrotzenden Haus- und Zugtiere, oft auf der Leitkuh der Herde reitend, zu meistern wissen. Am liebsten wühlen diese Rinder im Schlamm, und es ist eine Lust, ihnen zuzusehen, wenn sie in den über die Weide verstreuten Tümpeln Schlammbäder nehmen. Ihr Futter besteht nun allerdings nicht aus zarten Alpenkräutern, sondern rauhen Steppen- und Hirsegräsern, die sie ganz kurz abweiden. Nur den Adlerfarn, dieses Allerweltunkraut, das alle Erdteile bewohnt, lassen sie stehen. Es ist diese letztere fast die einzige Pflanzenart, die man « von zu Hause » her kennt, wenn man in die Tropen kommt!
Nach einer kleinen Stunde kommen wir an den Urwaldgürtel ( zirka 1400 m ). Wir sehen, wie die Eingebornen den Wald brennen, um neues Land für den Reisbau zu gewinnen. Die kleineren Bäume werden etwa einen Meter über dem Boden gefällt. Darauf lässt man sie verdorren und steckt sie nachher in Brand. Dem sengenden Feuer fallen dann auch die Urwaldriesen, die nur geringt wurden, zum Opfer. Dicht neben den rauchenden Baumleichen spriesst die wunderbare, hellgrüne Reissaat aus dem fruchtbaren, dem Walde abgewonnenen Boden. Leider verstehen es die Bataker noch nicht, durch richtige Bewirtschaftung dem Boden seine Fruchtbarkeit zu erhalten, so dass er rasch durch Abspülen und alles verstickende Steppengräser verarmt. Erneutes Abbrennen der so entstandenen Steppen verschlechtert die Bodenkrume noch mehr, so dass solche Gegenden nur mit der grössten Mühe wieder bewaldet werden können, wovon die Förster des niederländisch-indischen « Boschs-Wesens ein trauriges Lied zu erzählen wissen. So sieht man denn mit geteilten Gefühlen dem grausig-grandiosen Schauspiele eines nächtlichen Urwald-brandes zu!
Und nun geht 's, immer steigend, hinein in den Urwald. Es ist fast unmöglich, ihn zu beschreiben, und so kommt es, dass man trotz aller Lektüre über tropische Vegetation immer wieder erstaunt, überrascht sein wird, wenn man zum erstenmal in den Bann des tropischen Urwaldes tritt. Wald-riesen und Baumleichen stehen weniger dicht als z.B. im Arvenurwald von Tamangura ( Val Scarl ), aber die Stämme und Kronen sind so gewaltig, dass sich hoch über uns das Blätterdach schliesst; aber nicht gleichmässig: 10, ja 20 m ragt ein Wipfel über seine Nachbarn, so dass das Profil durch den tropischen Urwald viel unregelmässiger wird als durch unsere heimatlichen Wälder. An diesem Gerüst von Riesenbäumen entwickelt nun aber erst die tropische Vegetation in ungeahnter Variation ihre Schätze; ein üppiges Baum- und Strauchuntergehölz, Lianen, die wie Taue an den Stämmen hangen ( Fig. 5 ), kletternde Rotanpalmenspanisch Rohr ), die sich mit Hilfe ihrer mit schaurigen Widerhaken versehenen Fangarmen überall emporarbeiten, stachlige Farnbäume und rankendes Gestrüpp aller Art. Überall herrscht eine muffig-heisse Treibhausluft, die einem den Schweiss in Strömen aus den Poren treibt. Der hohe Wasserdampfgehalt der Luft schafft ein weiteres Charakteristikum des Tropenwaldes: die eigenartige Epiphytenflora. Riesige Vogelnestfarne umklammern die Stämme oder sitzen auf Aststümpfen; wundervoll blühende Orchideen hangen vom Gezweige herab; in den Genfer-farben prangende Fruchtähren der Ingwergewächse leuchten von der hochgelegenen ersten Gabelung der Riesenbäume herab; überall kletternde Farne und Flechten.
Eigentlich müsste man mit nach oben gerichtetem Haupte durch den Urwald gehen! Um so mehr, da man am Boden zu seiner grossen Enttäuschung sozusagen nichts Blühendes findet, wenn man sich durch seine Kulis den Weg bahnen lässt. Längs des Sinabunweges ist es zum Glück anders. Da haben sich in dichten Scharen Urwaldblumen versammelt, die sonst in solchen Mengen auf Lichtungen, welche fallende Riesengreise schlugen, beschränkt sind. Ihren durchscheinenden, zerbrechlichen Stengeln sieht man ihre Feuchtig-keitsansprüche deutlich an. Da blühen verschiedene Begonienarten mit riesigen Schiefblättern, rosa und gelbe Balsaminen, zum Teil Springkraut ähnlich, viele Arten einer Urwaldgattung ( Argostemma ), die mit dem Waldmeister verwandt ist ( Rubiaceen ), alle weissblühend.
Im Gegensatz zum Urwald in der Ebene mit lauter fremden Pflanzen, besitzt dieser Gebirgsurwald entfernt « heimatliche » Züge: die Baumriesen, sind zum Teil immergrüne Kastanien und Eichen, deren typisch erkennbare, doch teils eigenartig veränderte Früchte wir am Boden finden. Tropische Himbeerarten, die jedoch verzweifelt bitter schmecken, ranken im Gebüsch. Aber auch vieles Exotische streut uns der Wind, der durch die Wipfel braust, vor die Füsse: Muskatnüsse, die wie Mandeln in einem grossen, grünen Fruchtfleisch sitzen, wilde Mandarinen von prangendster Orangefarbe, doch saurer als die sauerste Zitrone — und die verschiedensten unessbaren Feigensorten, von erbsen- bis zu faustgrossen.
Etwa bei 1750 m tauchen wir aus dem Urwald auf und kommen in die Strauchzone. Der Blick wird frei; wie an der Baumgrenze stehen vereinzelte Baumleichen im Gesträuch. Schon jauchzt das Herz, fröstelt aber zugleich etwas ob diesem ungewohnt schroffen Übergang. Die Baumstrünke sind hier nicht sturmgebleicht, sondern schwarz verkohlt — ein beissender Schwefelgeruch fährt auf einmal über uns hin, wir sind ins Streichgebiet der Solfataren-dämpfe gelangt. In dieser Schwefelluft können keine Bäume mehr wachsen, so dass eine vulkanologische Waldgrenze entsteht, während die klimatologische hier über 2500 m, also etwa so hoch wie die Schneegrenze der Alpen, liegen müsste. Den Schwefeldämpfen widerstehen nur Farne und die eigenartigen tropischen Grasbäume ( Pandanaceen ), die in Ermangelung eines richtigen Stammes ihre riesigen yucca- oder agaveähnlichen Kronen durch die abenteuerlichsten Stelzwurzeln zu stützen versuchen.
Der Weg führt an einem seitlichen Riss des Vulkans hinan, wir blicken in eine tiefe Schlucht, in der zwei Solfataren brodeln. Der Sinabun ist ein erlöschender Vulkan, der in das letzte oder hydrotherme Stadium seiner Tätigkeit eingetreten ist. Er speit nicht mehr Asche und Lava, sein Krater ist tot. Aber zahlreiche warme Quellen, Fumarolen und Solfataren verraten noch, dass das glühende Magma hier früher einen Ausweg aus dem Erdinnern gesucht hatte. Fauchend tosen die Solfataren in der Schlucht, jede einen kleinen Schwefelkrater um sich bauend; bis zur Kante der Bergspalte hinauf leuchtet abgesetzter Schwefel in der Abendsonne und kontrastiert prächtig gegen den blauen Himmel. Auch jenseits der Schlucht stehen verwüstete Bäume, fast wie längs eines Lawinenzuges. Da die Solfataren ihre Ausbruchstellen von Zeit zu Zeit verändern, herrscht ein ständiges Vordringen und Zurückdrängen des Waldes, je nach den Gebieten, die der Wind mit den der Schwefelquelle entrissenen giftigen Gasen zu bestreichen vermag.
Wir benützen eine kurze Rast, um die Aussicht zu bewundern. Endlos dehnt sich die Hochebene von Nordsumatra vor uns, umsäumt von den bewaldeten Randgebirgen. Zahllos liegen die KampongsDörfer ) der Eingebornen in kleinen Bambuswäldchen über das Land zerstreut. Die tief eingefressenen Kanontäler, die man sonst kaum sieht, treten durch die seitliche Abendbeleuchtung reliefähnlich hervor, und die ganze Ebene enthüllt sich als ein runzliges, buckliges Hügelland. Da und dort kleine Äckerchen, fern in der Tiefe, wo sich die Täler weiten, SawahsRieselwiesen des nassen Reisbaues ), sonst überall die sonnverbrannte, braune Steppe. Wie vom Flugzeug aus liegt alles so unmittelbar unter uns. Weit im Süden liegt der riesige Trichter des Tobasees, wir erkennen die paar Häuser von Kaban Djahé und dahinter den Kurort Brastagi ( 1400 m ), vorgelagert der Ostkette mit dem geborstenen Vulkan Sibajak ( 2094 m ) und der schönen Pyramide des Pintau ( 2212 m ), die an frühere Bergfahrten erinnern. Im Westen türmt sich eine riesige Föhnwolke auf, die der Wind vom Indischen Ozean dort hinauf gemauert hat. Beim Fallen auf die Hochebene oder gar hinunter auf die Ostküste wird dieser Wind trocken und föhnartig drückend; die Eingebornen nennen ihn Bohorok.
Wir sehen den Gipfel unseres Berges noch nicht; aber an seinem Schatten, der sich weit über die Ebene projiziert, erkennen wir zu unserem Schrecken, dass sich auch die Spitze des Sinabun an dem gewaltigen Wolkenschauspiel der Westküste beteiligt und fortwährend Wasserdampf des oben feuchten Westwindes kondensiert. So droht die Wolke über uns, die wir erst nur für einen jener Nebelfetzen hielten, die sonst um diesen Vulkan streichen, zum hartnäckigen Spielverderber zu werden.
Wir steigen weiter. Die Flora wird immer alpiner, was um so auffälliger ist, da wir uns ja gar nicht in einer klimatologischen, sondern durch giftige Gase bedingten Strauchzone befinden. Dumpf tönt der Boden, auf dem wir klettern; so tief wir den Stock hinein stecken, besteht er aus torfartigem Humus. Bärlappgewächse kriechen über den Boden, und riesige Alpenrosen tauchen im Gebüsch auf. Eine grosse, tieffeuerrote Rhododendronart, so schön, wie man sie in keinem europäischen Rhodoretum findet. Ein Zweig ist ein ganzer Strauss von grossen Glocken, die prachtvoll glühen in der Abendsonne. Dies ist der letzte Sonnenblick unserer abendlichen Besteigung.
Wusch — fällt der Nebel auf uns herab. Zischend zerrt ihn der Abendwind talwärts. Es wird dunkel und frostig-feucht. Wir sind erst zirka 2000 m hoch, und schon ist es nach 5 Uhr! Der geizige Tropentag mit seinen ewigen zwölf Stunden von morgens 6 bis abends 6 ist kein Freund der Bergsteiger. Objektiv genommen, ist dieser Nebelschauer psychologisch sehr « interessant ». Mein Begleiter bemerkt plötzlich, dass er als Flachlandwanderer das Steigen nicht gewohnt ist und die Knie kaum mehr heben kann; die Träger müssen auf einmal merkwürdig oft ihre Last niedersetzen, um auszuschnaufen, und unser Führer brummt, dass « man » im Urwalde zu viel « botanisiert » habe, obschon er als affenartiger Baumkletterer durch seine Künste am meisten zur Verzögerung beigetragen hatte. Auch mir selbst wird erst ganz wohl, als ich meinen Rucksack auf dem Rücken spüre. Trotz den Widersprüchen des Führers gibt der Träger den Sack gerne her, denn er hat « Wichtigeres » zu tun. Alles Krüppelholz und tote Geäst, das uns begegnet, rafft er auf und schleppt es mit. Nach einer Stunde sind wir bei Sturm und Nebel bei der Unterkunftshütte. Der letzte Dämmerungsschimmer reicht gerade noch, um mit Massik nach der versprochenen Quelle zu eilen, um zu sehen, ob ihr Wasser wenigstens für Kochzwecke hygienisch einwandfrei sei, was zum Glück zutrifft.
Nun könnte ein gemütliches Hüttenleben beginnen! Aber nichts ist da, kein Stuhl, kein Tisch, nur Schragen zum Schlafen. Der Boden ist feucht, und nass pfeift der Nebelwind durch alle Spalten und Lucken. Es tritt der merkwürdige Zustand ein, dass man trotz warmer Kleidung in den Tropen zu frieren beginnt! Zähneklappernd nehmen wir stehend unser Abendessen ein, kleiden uns um und kriechen in unsere mitgebrachten Decken.
Die Bataker haben unterdessen im Vorraum der Hütte ein Feuer angefacht, dessen Qualm droht uns auszuräuchern. Trotzdem bringen wir 's nicht übers Herz, ihnen zu wehren, denn sie haben als richtige Kinder der Natur nichts bei sich: kein Essen, kein Licht, kein Messer, nichts, was sie als Menschen auszeichnet — ausser ihr primitives Rauchzeug! An Kleidern nur Hemd, Hose und ein Bataktuch, das sie wie eine Toga um sich hüllen. Aber zu feuern verstehen sie gut. Die paar Prügel, die sie mitgenommen, reichen für die ganze Nacht. Pustend halten sie ihre nackten Füsse und nassen Tücher in die Flamme. Mit ein bisschen Speise und warmem Wasser sind sie zufrieden und hocken die ganze Nacht stillbrütend um das Feuer.
Unterdessen braust draussen der Sturm immer stärker, man muss die Decke über den Kopf ziehen, so pfeift es um die Ohren. Und wie verzweifelt lang ist so eine Tropennebelnacht! Zwölf Stunden Nacht, man kann sie fast alle an der Uhr ablesen, denn jede halbe Stunde weckt einen das Geschrei des Sturmes. Periodisch schwillt er an und nimmt dann wieder ab, aber nur, um doppelt heftig einzufallen, so dass die Hütte ganz erschüttert wird. Unwillkürlich denke ich an jene Saanenlandsage, wo der Meisterknecht schliesslich das Tor aufreisst, um die wilden Jäger durch die Hütte fahren zu lassen. Wie eigentümlich hier diese Erinnerung unter tropischem Himmel bei den Batakern!
Endlich graut der faule Morgen heran. Aber milchig weiss schaut er zur Dachlucke herein; der Nebelsturm geht weiter. Wir kochen Kaffee und warten, eine Stunde, zwei Stunden. Der Führer geht vor die Hütte und schreit in den Wind. « Minta trang sama tuan Allah » ( ich bitte um Sonne beim Herrn ), erklärt er uns. Auf unsere Frage, zu welchem Herrn er bete, sagt er, er sei weder Islamit noch Christ, aber einen Herrn habe er doch.
Schliesslich steigen wir im Nebel auf den Gipfel. Von der vielgepriesenen Aussicht keine Spur, nicht einmal den Krater sehen wir, dessen Dämpfe wir riechen, geschweige dann den Bergsee Lao Kawar, auf den wir uns so gefreut hatten. Aber zu sehen gibt es doch genug.
Eine ganze Reihe von Bambusstecklein steht auf dem Gipfel; sie sind oben gespalten, und in die Spalten sind Sirih-Blätter geklemmt — oder gar Zigaretten. Andere Stecklein tragen Scheiben von Zuckerrohr oder Reis, in ein Bananenblatt gewickelt. Dies sind Opfer, welche die altgläubigen Bataker dem heiligen Berggeist des Sinabun weihen. Der Führer erzählt, dass nur noch Greise und alte Frauen an ihn glauben und zu ihm hinauf wallfahrten. Die jüngere Generation, die zum Teil zur Schule geht, aber nicht mehr. Gespenstisch heben sich die im Winde zitternden Opferstecklein vom weissen Nebel ab — ein Wahrzeichen sterbenden Heidentums, das in diesen Bergen eine letzte Zuflucht gefunden hat. Daneben steht der modernste Totalisator, vom meteorologischen Dienste der Tabakversuchsstation in Medan da hinauf verpflanzt; wahrhaftig ein grotesker Gegensatz! Dieser Nebelausschnitt ruft einem grell in Erinnerung, dass in der kulturellen Entwicklung dieses Landes etwa 2000 Jahre übersprungen worden sind.
Das Wetter ist hoffnungslos. Ein regenartiger, alles durchnässender Nebelschauer fegt über den Kraterrand und zwingt uns zum Abstieg. Auch in der feuchtfrostigen Hütte, in der es innen und aussen wie von einem Dach mit Märzenschnee tropft, ist kein Bleiben. Die einzige Hoffnung, die uns bleibt, ist, dass sich die Nebelkappe vielleicht gegen Mittag höher hinauf hebe, an ihre vollständige Verflüchtigung wagen wir nicht mehr zu glauben. So steigen wir etwa bis 2000 m hinunter und warten in den Rhododendronhängen. Der Nebel ist da blendendweiss, oft schleierhaft, aber die Sonne sieht man noch nicht durchscheinen. Der Wind ist hier schwächer, und hinter den mehr als mannshohen Grasbäumen sind wir vor ihm geschützt.
Da — plötzlich tut sich ein Riss auf. Blitzartig öffnet sich ein Blick über die Ebene und verschwindet wieder. Dann jagt ein Schleier vorbei und lässt die milchige Scheibe der Sonne erraten — und hier einen Streifen blauen Himmels! Alles ist phantomhaft, auftauchend, vom Winde gepeitscht und sofort wieder verschwindend. Doch auf einmal hebt sich der ganze Vorhang, wir sitzen in der lachenden Sonne.Viel höher steigt der Wolkenhut des Sinabun nicht, wir bleiben dicht unter seinem Rande und verfolgen mit Spannung das grossartige Wolkenschauspiel, das sich unserem geblendeten Auge darbietet. Von der Föhnmauer der Westkette lösen sich Wolkenbrocken und jagen zu unseren Füssen hintereinander her über die 50 km breite Hochebene nach der Ostkette, wo sie sich wieder stauen. Zwischendurch leuchtet der strahlendste Sonnenschein. Tausendfältig variiert dieses Spiel, das man stundenlang verfolgen möchte.
Die Aussicht von einem so völlig isoliert stehenden Berge, der alles Umliegende hoch überragt, ist kaum zu beschreiben. Losgelöst von allem Irdischen stehen wir über den Wolken, schauen durch gähnende, durchsonnte Spalten ins flache Land und trinken in tiefen Zügen die unendlich sich weitende Ferne.
Medan, August 1929.