Flachs und Hanf und ihre Verarbeitung im Bündner Oberland
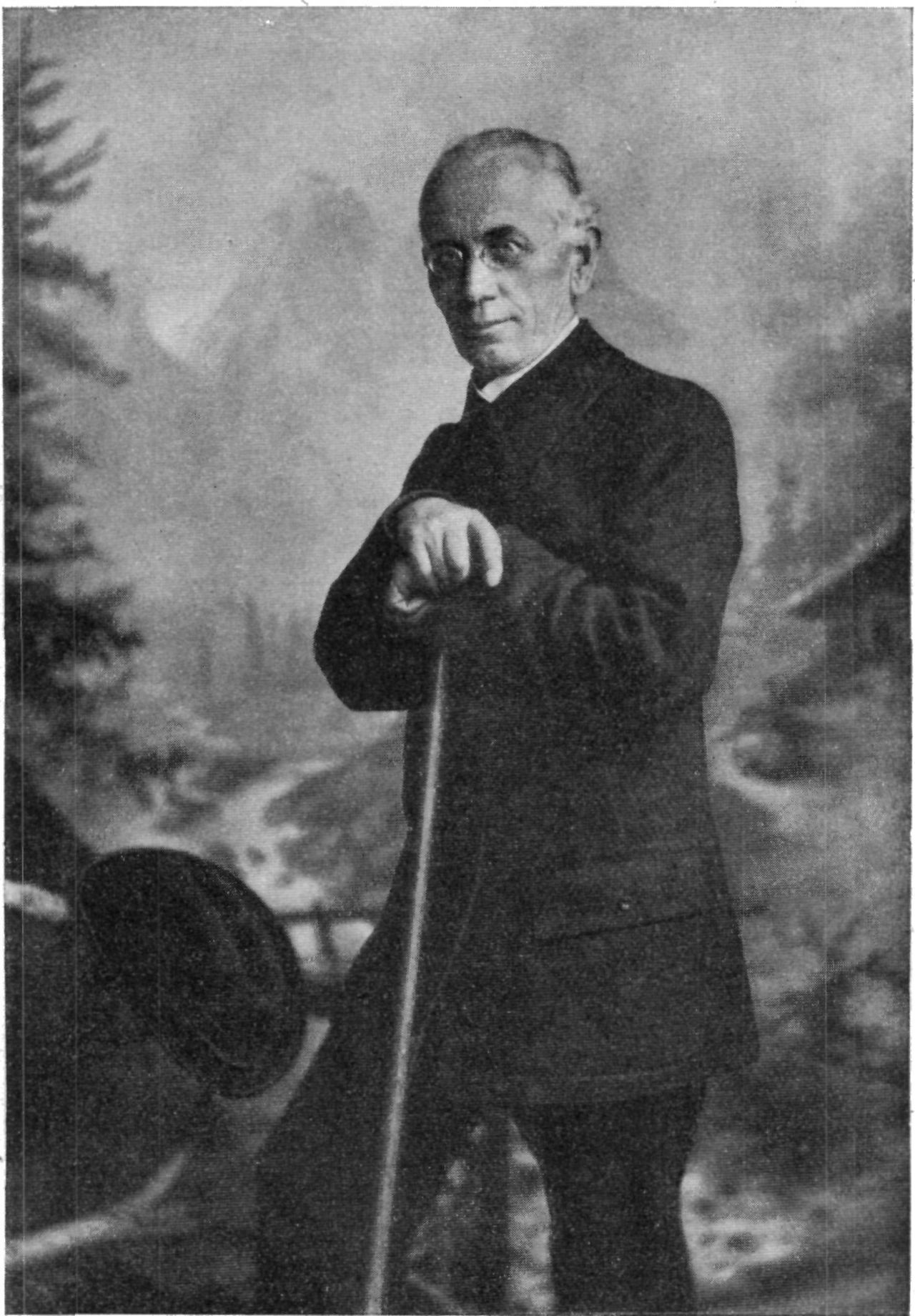
Kulturwissenschaftliche Skizzen von t P. Dr. Karl Hager, Disentis.
Mit 9 Incavotafeln und 10 Textfiguren nach Aufnahmen des Verfassers und einem Bildnis desselben.
Vorwort.
Vorliegende posthume Abhandlung des am 11. Juli 1918 verstorbenen Verfassers bildet einen kleinen Teil einer umfassenden Arbeit, betitelt: „ Landschaft und Ackerbau des Bündner Oberlandes ", in welcher er die gesamte Pflanzenkultur und Pflanzenverwendung der Sursilvaner mit reicher illustrativer Ausstattung darzustellen beabsichtigte. Leider überraschte ihn der Tod vor der Vollendung dieses Werkes. Nur die vorliegenden Kapitel waren druckfertig; wir konnten sie noch gemeinsam durchgehen, die Abbildungen etikettieren und einfügen, und es war ein dringender Wunsch des Verfassers, sie durch den S.A.C. im Jahrbuch publiziert zu wissen. Dem Zentralkomitee und unserm Redaktor gebührt wärmster Dank, daß sie diesen Wunsch des tief betrauerten Alpinisten in so reichem Maße erfüllt haben!
Es möge gestattet sein, hier einen kurzen Lebensabriß des ausgezeichneten Forschers vorauszuschicken:
Geboren zu Kaltbrunn am 19. November 1862 als Sohn einfacher Eltern, besuchte Hager von 1875 bis 1880 das Gymnasium in Engelberg. Im Herbst 1880 trat er ins Kloster Disentis ein. Von 1901 bis 1905 widmete er sich an der Universität Freiburg im Üchtland den Naturwissenschaften und promovierte dort mit einer Arbeit über das Gebiß der Schlangen. In Disentis lehrte er an der Klosterschule Deutsch und Naturwissenschaften 32 Jahre lang. Er hat sich in die Natur und das Volksleben seiner zweiten Heimat, des Bündner Oberlandes, eingelebt wie kein zweiter. Die einsichtige Leitung des Klosters gewährte ihm die nötige Bewegungsfreiheit und zum Teil auch die Mittel zu zahllosen Exkursionen. Er war ein unermüdlicher Gänger von seltener Ausdauer, so daß man von ihm sagte, es halte es kein Träger länger als zwei Tage mit ihm aus! Stets begleiteten ihn Stativ und Kamera, denn er war ein technisch und künstlerisch hervorragender Photograph. Seine bevorzugte Stellung als Angehöriger des Klosters verschaffte ihm überall Zutritt und willige Auskunft über wirtschaftliche Dinge, und sein einfaches gerades Wesen, gepaart mit einem köstlichen trockenen Humor, machte ihn überall zum gern gesehenen Gast. So hatte er im Laufe der zweiunddreißig Jahre die naturwissenschaftliche, kultur- geschichtliche und folkloristische Erforschung des Bündner Oberlandes so emsig gefördert, daß man ihn mit Recht als „ Pater Placidus a Spescha redivivus " bezeichnete.
Seine alpinistischen Leistungen sind bedeutend: Er hat im Bündner Oberland zahlreiche Gipfelbesteigungen ausgeführt und Hunderte prächtiger Aufnahmen yon Landschaften, von Panoramen und von Vegetationen gemacht. In der Beilage zu diesem Jahrbuch Nr. 36 ( 1900 ) erschien sein photographisches Panorama vom Gipfel des Oberalpstockes ( 3300 m ), im 44. Band ( 1908 ) publizierte er ein zweites derartiges Panorama, das vom Badus ( 2931 m ); im gleichen Band erschien seine trefflich geschriebene Abhandlung „ Streifzüge zwischen den Arven und Bergföhren am Lukmanier ", durch 13 prächtige Aufnahmen illustriert. Drei touristische Führer stammen aus seiner Feder: „ Das Tavetschertal an den Rheinquellen ", 32 Seiten, Queroktav, mit 30 Aufnahmen; „ Führer für Disentis und Umgebung ", 23 Seiten, mit Exkursionskarte; „ Curaglia ", 24 Seiten, Queroktav, mit 22 Illustrationen ( 1912 ). Vielen Naturforschern diente er als kundiger Führer, wenn sie in seinem Gebiet zu arbeiten kamen.
Hager war seit 1900 Mitglied der Sektion Terri des S.A.C.; zahlreich waren seine Lichtbildervorträge mit dem auf seine Anregung angeschafften Apparat. Die Sektion Rhätia, in deren Schoß er ebenfalls Vorträge hielt, ernannte ihn zu ihrem Ehrenmitglied. Auch in den Sektionen von Zürich, St. Gallen, Basel und Davos, sowie an der schweizerischen Naturforscherversammlung in Schuls-Tarasp 1916 hat er gesprochen und jedesmal die Zuhörer durch den Reichtum an schönen Bildern und den Enthusiasmus des Forschers entzückt.
Zwei hervorragende Werke hat Hager hinterlassen. Das erste, in Gemeinschaft mit Prof. Pieth und Pater Maurus Carnot herausgegebene, ist betitelt: Pater Placidus a Spescha, sein Leben und seine Werke ( mit 22 Tafeln, größtenteils nach Aufnahmen von Hager, und 17 Textbildern, Bern 1913 ). In dieser auf sorg-fältigstem Quellenstudium beruhenden Schrift hat Hager den naturwissenschaftlichen, geographischen, alpinistischen und volkswirtschaftlichen Teil behandelt. In den zahlreichen Anmerkungen Hagers zu den Schriften a Speschas steckt ein guter Teil der Landeskunde des Vorderrheintals. Das zweite Hauptwerk Pater Hagers ist speziell botanischer Natur: „ Verbreitung der wildwachsenden Holzarten im Vorderrheintal ( Kanton Graubünden ). 3. Lieferung des Sammelwerkes: Erhebungen über die wildwachsenden Holzarten der Schweiz, bearbeitet und veröffentlicht im Auftrag des schweizerischen Departements des Innern, unter Leitung des schweizerischen Oberforstinspektorats und des botanischen Museums der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich ( 331 Seiten in Quart, mit vier Lichtdrucktafeln und zwei farbigen pflanzengeographischen Karten ). "
Diese bedeutsame Arbeit, groß angelegt und großzügig durchgeführt, gilt als eine der besten pflanzengeographischen Monographien der Schweiz. Pater Hager bat hier in neun Sommern ein Gebiet von 745 km nach allen Richtungen bis in die fernsten Winkel auf seine Holzpflanzen, seine Gehölzformationen und deren Unterwuchs untersucht, dabei die 400 km lange Baumgrenze zweimal abgesucht, ein reiches Material kritisch gesammelt und eine bunte Verbreitungskarte in 1: 50,000 entworfen, die als mustergültig anerkannt ist. Die Arbeit greift weit über die im Titel enthaltene Grenze hinaus; eine geographische, geologische und klimatologische Einleitung schildert in gründlicher Weise die Natur des Gebietes und eröffnet manchen neuen Einblick in die klimatische Bedingtheit der Vegetation; die Studien über den Flachs und Hanf und ihre Verarbeitung im Bündner Oberland.
Zusammenhang der Gehölzvegetation mit den Kulturen führen den Verfasser zu einer eingehenden Darstellung des gesamten Wirtschaftslebens der Sursilvaner.
Anschließend an diese letztgenannten Untersuchungen hatte nun Pater Hager seither mit dem ihm eigenen Feuereifer seine Studien über die gesamten Kulturen und die Pflanzenprodukte des Bündner Oberlandes fortgesetzt. Er verfolgte den t P. Dr. Karl Hager, geb. 19. November 1862, gest. 11. Juli 1918.
Sursilvaner Bauern und seine Familie bei all ihren pflanzenbaulichen Betätigungen: pflügen, eggen, säen, jäten, ernten, dreschen, mahlen, brotbacken, beim Bereiten der Hanf- und Flachsfaser, beim Spinnen und Weben, beim Pressen des Leinöls. Stets wurden alle Stadien und Geräte photographiert oder skizziert, und sorgfältig alle romanischen Namen für Geräte und Hantierungen notiert. So ist eine in ihrer Vollständigkeit ganz einzigartige Sammlung von Notizen und Bildern zustande gekommen über die Kulturen und die Verwertung der Pflanzen im Leben eines konservativen Bergvolkes, das altehrwürdige Gebräuche noch unangetastet gelassen hat, eine Sammlung, die um so wertvoller ist, als gerade die Not der Kriegszeit mancherlei Veränderungen brachte. Die vorliegenden Kapitel sind leider der einzige druckfertige Niederschlag dieser Studien.
Noch ein weiteres Projekt Hagers, eine „ Gesamtflora des Bündner Oberlandes ", wird mit ihm begraben. Er hat dafür ein reiches Material gesammelt, das wohl der wissenschaftlichen Verwertung nicht entzogen bleiben wird.
Mit Hager ist ein Vertreter jener durch die dominierende Laboratoriumsbiologie immer seltener gewordenen, heutzutage aber glücklicherweise durch die Belebung der Feldbiologie wieder neu auflebenden Gilde der Naturforscher ins Grab gesunken, welche mit der freien Natur in allen ihren Erscheinungsformen in lebendigem, innigem Kontakt steht. Er war nichts weniger als einseitig: seine reichen geschichtlichen, kulturhistorischen und literarischen Kenntnisse traten im Gespräch oft ganz überraschend zutage. Gesteine, Mineralien und Tiere kannte er so gut wie seine über alles geliebten Pflanzen. Er hat z.B. für die Klosterschule eine schöne Sammlung von ihm selbst ausgestopfter Tiere hergestellt und eine Mineraliensammlung zusammengebracht, die das Entzücken der Kenner bildet. Seine Begeisterung für die Pflanzen kannte keine Grenzen; ich habe nie einen Menschen gesehen, der über einen interessanten Pflanzenfund so in Ekstase geraten konnte wie Freund Hager!
Wahrhaft erhebend war die Gelassenheit, mit der er dem Tode ins Angesicht sah, und die philosophische Ruhe, die Umsicht, mit der er das Schicksal seines wissenschaftlichen Nachlasses besprach. Man hatte das tröstliche Gefühl, daß hier ein arbeitsreiches Leben einen harmonischen Abschluß finde und ein edler Mensch mit ruhigem Gewissen dem Unabänderlichen sich füge.
Die schweizerischen Naturforscher haben einen guten, vollwertigen Kameraden verloren; das Kloster Disentis und seine Heimatsgemeinde nannten ihn mit Stolz den ihrigen; der edle, warmherzige, idealgesinnte Mensch wird allen seinen Freunden unvergeßlich bleiben.C. Schröter.
Einleitung.
1. Kapitel. Allgemeines über Natur und Kultur des Bündner Oberlandes.
Jedes gute Kartenbild der Schweizer Hochalpen zeigt dem Beschauer aufdringlich zwei der größten Alpentieftäler, die in der gleichen südwest-nordöstlichen Längsachse liegen: das Rhone- und das Vorderrheintal. Die Punkte Martigny-Brig-Ander-matt-Disentis-Ilanz-Chur lassen sich durch eine gemeinsame Gerade verbinden. Die Gebirgsstauung des Gotthardmassivs trennt auf eine kurze Strecke diese beiden mächtigen Talfurchen, verbindet sie aber wieder durch die Furka- und Oberalpstraße und das dazwischen liegende1 kleine mattengrüne Urserental.
Der nordöstliche Schenkel, das Vorderrheintal, verdankt seinen Namen den Quellen des Vorder- und Mittelrheines und seiner langgestreckten Wasserrinne. In ihm liegt das Graubündner Oberland, die sogenannte romanische „ SurselvaObwalden.
Flachs und Hanf und ihre Verarbeitung im Bündner Oberland.
Sein Talhintergrund lehnt sich an den St. Gotthard ( Oberalppaßhöhe 2048 mseine Ausgangspforte öffnet sich bei Reichenau ( 566 m ); dort schnüren die mächtigen Schuttmassen des prähistorischen Flimser Bergsturzes das Bündner Oberland vom Churer Rheintal ab. Die Tallänge beträgt rund 60 km, die Steigungsdifferenz aber 1462 m.
Wir unterscheiden vier große, aufeinanderfolgende Talstufen: das Talbecken von Ilanz mit 700 m Höhe am Rheinwasserspiegel, jenes von Truns-Somvix mit rund 900 m Talbodenhöhe, das Talbecken von Disentis mit 1150 m, endlich die weite Talmulde von Sedrun im Tavetschertale bei 1400 m unterer Talsockelhöhe. Diesem gleichwertig steht das nordfallende seitliche Medelsertal am Lukmanier. Fünftens dürften wir noch als oberste kleine Stufen längs der Haupttalrinne die Mulden von Selva und Tschamut im hinteren Tavetschertal anführen; sie bergen zwischen 1550 und 1700 m die höchstgelegenen Jahressiedelungen mit Ackerbaubetrieb.
Der lange, stufenmäßig fallende Graben des Vorderrheintales besitzt rechts und links keineswegs gleichartige, einheitliche Gebirgsflanken. Rechts streicht das östliche Gotthardmassiv und sinkt in der Greinahochebene unter den Bündnerschiefer der Adula; linksufrig im Norden aber stoßen die Gebirgszinnen des Aarmassivs bis zum Russeiner- und Pontegliastal vor und tauchen dort unter den mächtigen Sedimentmantel der autochthonen Kalke der Glarneralpen. Die hintere Talhälfte entspricht tektonisch etwa dem Rhonetal im Oberwallis; das Ganze aber liegt in der Wurzelzone der heute zur Ruhe gekommenen nördlichen helvetischen Decke. Mächtige Dreitausender zieren rechts und links, in langer Reihe, das Vorderrheintal; als höchster nördlicher Gipfel erhebt sich der Tödi ( Piz Russein, 3623 m ), als stärkster im Süden der Scopi am Lukmanier ( 3200 m ).
Nach Penks Darlegung ( Die Alpen im Eiszeitalter ) liegen das Ilanzer, Trunser und Disentiser Talbecken im Würmtrog; die Schultern dieses Troges bilden die prächtigen und reich besiedelten Terrassen von Obersaxen im Süden und Waltens-burg-Brigels im Norden; beide trennt die enge, lange und waldreiche Schlucht der Pardiala ( Pardella ). Die Formen aller Talgehänge sind meist mild und sanft und tragen eine üppige Pflanzendecke von Wäldern, Weiden und Ackerland.
Die vielen nord- und südfallenden Nebentäler zeigen hohe Stufenmündungen; nur drei besitzen Jahressiedelungen. Am stärksten ist das Lungnez mit Talmündung bei Ilanz bewohnt; ihm folgt das Medelsertal am Lukmanierpaß, der durch die wildromantische und gigantische Medelserkluse mit dem Haupttal bei Disentis verbunden wird. Zwischen beiden liegt noch das schwach bewohnte und stark bewaldete Somvixertal mit Paßübergang zur Greina-Hochebene. Die vielen übrigen sind sämtlich Hochtäler mit Alpviehweiden; nach Norden leiten sie oft zu Paßübergängen, so zum Krüzli bei Sedrun im Tavetsch, zum Brunni und zur Sandalp bei Disentis, zum Robi-Kisten bei Brigels, zum Panixer und Segnes bei Ilanz und Flims.
2. Kapitel. Klima und Pflanzendecke.
Der Ansiedler einer Landschaft ist von der natürlichen Pflanzendecke seines Wohnsitzes abhängig. Er kann sie teilweise umgestalten, ja vielfach hat er sie zu seinem Schaden verpfuscht; wesentlich aber drückt die Pflanzenwelt, als seine Ernährerin, ihm Physionomie und Charakter auf.
Die natürliche Pflanzendecke richtet sich nach dem Landesklima. Das bündnerische Vorderrheintal gehört zu den zentralalpinen Föhrentälern. Diese Föhrenregion ist im allgemeinen durch das Vorherrschen von Föhren, Lärchen, Fichten und Traubeneichen gekennzeichnet; dagegen fehlen ihr die Rotbuchen, Hainbuchen, Ahorne, Kastanien und Weißtannen gänzlich oder treten doch stark zurück. Selbstverständlich unterliegt der Vegetationscharakter örtlichen Abänderungen; dies gilt besonders vom bündnerischen Vorderrheintal. Nur das ausgedehnte Waldgebiet auf der Kalkbreccie des Flimser Bergsturzes hat herrliche Föhrenbestände; sonst sind deren Areale eingeschränkt; sie reichen bis Disentis mit 1800 m oberer Höhengrenze. Noch spärlicher tritt deren Schwester, die Arve, auf; ihr Hauptgebiet liegt im Medelsertale am Lukmanier. Ähnlich steht es mit der Verbreitung der Lärche; einzig das Ilanzer Talbecken und der Lukmanier zeigen wieder größere Standorte. Doch hatten Waldföhre, Bergföhre, Arve und Lärche ursprünglich vor dem Eingreifen der Menschenhand eine stärkere Ausdehnung, wie zahlreiche subfossile Hölzer und Früchte über der heutigen Baumgrenze beweisen. Der verbreitetste Waldbaum bleibt allenthalben die Fichte oder Rottanne; ihr geschätztes feinfaseriges Holz und dessen Ausfuhr bilden den Reichtum der Bündner Oberländer.
Die Trauben- oder Steineiche ist innerhalb der montanen Stufe ebenfalls ein markanter Baum der zentralalpinen Föhrenregion. Sie bestockt vorwiegend die warmen Südlagen der Trunser und Ilanzer Talmulden; nirgends wird sie angepflanzt und doch erobert sie jedes freie Plätzchen, das der Äcker- und Wiesenkultur entzogen ist. Im Verein mit Bergahorn, Esche, Birke, Mehl- und Vogelbeerbaum gestaltet sich die Steineiche zu prächtigen natürlichen Parkanlagen; selbst der Nußbaum mischt sich subspontan, d.h. verwildert, in den unteren Rand dieses Berglaubwaldes. Im Frühmittelalter wurde die Steineiche jedenfalls auf Kosten der Waldföhre bevorzugt; denn in ihre Haine trieb man die Schweine zur Eichelmast. Solche Eichenwälder bei Ilanz werden schon aus dem 8. Jahrhundert erwähnt.
Alle diese Waldbäume weisen so recht auf den vorwiegend kontinentalen Klimacharakter des Gebietes hin. Trotzdem zeigen sich manche Abstufungen zu einem Mittelklima und sogenannte „ lokale ozeanische Nuancen ". Wir beobachten in erster Linie eine starke spontane Verbreitung der Weißtanne. Sie geht bis ins vordere Tavetschertal und besiedelt allgemein Nord- wie Südlagen. Ihre großen natürlichen Bestände sind durch die Forstwirtschaft der letzten vier Dezennien eingeschränkt worden. Das Kreisforstamt der Ilanzer Talmulde versicherte uns, daß ohne beständigen Kampf die Weißtanne wegen ihrer ausgiebigen Vermehrungskraft die wirtschaftlich wertvolleren Fichtenbestände erdrücken würde; und dies in einem Talbecken, das doch als die extremste Trockeninsel des Bündner Oberlandes bekannt ist.
Auf ein lokales Mittelklima deuten ferner die vielen Waldbegleiter hin, die wir sonst vorwiegend in den geschlossenen Buchenbeständen antreffen. Die Buche selbst fehlt dem bündnerischen Vorderrheintal ebenfalls nicht ganz. Sie dringt auf der Nordlage in zerstreuten Horsten und Strichen von Ilanz bis ins weit entfernte Somvixertal vor, trägt noch bei 1260 m Höhe gute keimfähige Früchte und entfaltet stattliche Baumformen. Nirgends begegnen wir historischen Spuren von früheren Anpflanzungen, wohl aber uralten Flurnamen, wo heute die Buche fehlt. Bis vor wenigen Jahren war der schöne Waldbaum vogelfrei; jedem jungen Stämmchen wurde unbarmherzig nachgestellt, um gute Werkzeugstiele zu ergattern; nun steht die Rot- Flachs und Hanf und ihre Verarbeitung im Bündner Oberland.
buche ebenfalls unter den schützenden Fittichen des sorgsamen Försters; ihre Aufforstung wird manchenorts an die Hand genommen.
Die Föhrenregion der zentralalpinen Täler ist außerdem durch den Besitz sogenannter xerothermer, d.h. Wärme und Trockenheit liebender Pflanzenarten ausgezeichnet. Herr Dr. Josias Braun-Blanquet in Zürich hat festgestellt, daß von den 147 xerothermen Arten der gesamten bündnerischen Föhrenregion auf das Churer Rheintal 91, auf das Unterengadin 87, das Domleschg 67, das Münstertal 61, das mittlere Albulatal 56 Arten treffen. Auf unser mächtiges Vorderrheintal fallen aber deren nur 43 Arten; das schon buchenreichere Prättigau besitzt noch 25 Föhrenpflanzen; der ganze Kanton Glarus aber mit seinen ausgedehnten Buchenbeständen hat bloß 11 von den 147 xerothermen Arten der rätischen Föhrenregion. Wir sahen deutlich, wie mit dem progressiven Steigen und Fallen der Föhrenpflanzen im umgekehrten Verhältnis ein solches der natürlichen Ausbreitung der Buche und ihrer Begleiter Hand in Hand geht.
Obschon die beiden stark umschlossenen Talbecken, Ilanz und Truns, die geringsten jährlichen Regenmengen aufweisen, so beobachten wir in ihrer unteren Zone dennoch eine relativ große Luftfeuchtigkeit. Ihr verdanken, im Verein mit einer extremen Sommerhitze, die krautigen Hochstauden dieser Landstriche die geradezu tropischen Riesengrößen und -formen. Diese lokale Luftfeuchtigkeit führt im Frühjahr und Herbst zu einer regelrechten Talnebelbildung; sie ist z.B. für die Erhaltung der Buche und ihrer Begleiter Lebensbedingung. Die Talnebel führen wir in erster Linie auf die Wasserverdunstung der ausgedehnten Erlenau-Areale des Rheines und Glenners zurück; auch die oft einfallenden, aber kurzfristigen und leichten Schneefälle im Frühjahr mögen dazu beitragen. Allein über den mit Dörfern besäten höheren Plateaus dieser beiden Talbecken, ferner westwärts, droben über der Disentiser und Sedruner Talmulde, endlich ostwärts, drunten über dem weiten Churer Rheintal, wölbt sich wieder gleichzeitig der nebelfreie, sonnenklare, „ kontinentale " Himmel.
Der Bündner Oberländerbauer sagt volkstümlich gut, er habe ein halbes Jahr Winter und ebenso lange Sommer; das sind seine beiden Jahreszeiten. Die starke Schneedecke des langen Winters ist, in Verbindung mit dem kommunalen Weidgang ( siehe unten ), allerdings ein mitbestimmender hemmender Faktor, in größeren Höhen als 1200 m noch Wintersaat zu pflanzen; sie wird dort nicht mehr ergiebig; besonders leidet der Winterroggen; daher herrschen in den mittleren und oberen Lagen die Sommersaaten weit vor. Anderseits speichert die lang dauernde Schneedecke den Kulturanlagen die nötige Feuchtigkeit auf, wenn mit dem rapiden Eintreten der Frühjahrsföhnwehen die Zeit der Anpflanzung fast kopfüber hereinbricht.
Innerhalb der Ackerbauzone ist beinahe die ganze Gesteinsunterlage silikat-reich und daher schwer wasserdurchlässig; die flüssigen Niederschläge rinnen rasch ab. Das lange Haupttal des bündnerischen Vorderrheines hat den größten Abfluß-faktor im gesamten Rheinstromsystem, nämlich 81 O/o. Deshalb erfolgt im Hochsommer längs der Südgehänge und der südgeneigten flachen Talböden eine regelrechte Wassernot und zwingt zur künstlichen Bewässerung der Kulturanlagen.
Auch die geringen sommerlichen Niederschlagsmengen tragen zur Wasserarmut bei; in Betracht kommen wesentlich jene der Vegetationszeit, die zwischen den 1. März und 1. Oktober fallen. Nur eine gleichsinnige Periode vermag wegleitend zu sein; wir wählen das zwanzigjährige Mittel der Trockenperiode von 1892 bis 1911 inklusive. Das durchschnittliche Mittel der sieben Vegetationsmonate erreicht seine Höchstzahl im Medelsertale am Lukmanier mit 106.5 mm Regenfall, dann folgt das Sedrunerbecken mit 103.9 mm; die Trunsermulde zeichnet bei Surrhein 94.7 mm; Ilanz hat nur noch 83 mm, indes Reichenau jenseits des Flimser Bergsturzes ( Churer Rheintal ) wieder 92.3 mm Regensumme aufweist. Diese Zahlen steigen und fallen in den einzelnen Monaten gleichmäßig proportional für jede der genannten Talschaften. Ilanz z.B. hat während der Vegetationsperiode das Minimum des Regenfalles, im Monat April = 62 mm, der Juni zeigt bereits 85 mm, der Juli 93 mm Niederschlag: das Maximum ist an allen Orten im Monat August — für Ilanz 109 mm. Diese Höchstzahl fällt auf die zweite Hälfte des Monats und übt auf hoher Alp und drunten im äckerreichen Talboden eher einen schädlichen Einfluß aus. Der Älpler sagt, die Milch der Alpkühe gehe zurück ( Temperatursturzim Talboden aber wird das eben ausreifende Sommergetreide durch diese Regenmengen oft zu Boden geworfen; sie haben auch die schnelle Flucht und Abreise der Erholung suchenden Kurgäste des Gebietes zur Folge.
Die Bewohner wissen den kostbaren spärlichen Regen wohl einzuschätzen. Auf die Frage, wie würden Sie sich das wöchentliche Wetter einrichten, wenn der liebe Herrgott Ihnen die Vollmacht erteilte, antwortete prompt ein Bäuerlein: je vier milde sich folgende Regentage und dann drei Tage vollen Sonnenschein. Dieser ehrliche Wunsch kam noch aus dem regenreichsten Medelsertal. Die maximale Regenhöhe des Gebietes am Lukmanier und St. Gotthard ( Medels und Sedrun ) ist in der geographischen Lage begründet. Die beiden Talschaften lehnen sich an die Zone, wo Rhein und Posystem zusammenstoßen, wohin die größten flüssigen Niederschläge des bündnerischen Rheinsystems fallen. Sie bewirken in diesen Hintertälern das rapide Ansteigen der Ackerbaugrenzen. Medels am Lukmanier pflanzt vierzeilige Gerste, Roggen, Kartoffeln und Flachs bis auf 1640 m ü. M.; die gleichen Früchte erntet das Tavetsch ( St. Gotthard ) sogar bis auf 1730 m ü. M. oberhalb Tschamut.
In den drei warmen Talbecken, Disentis, Truns und Ilanz, stehen die oberen Ackerbaugrenzen bedeutend tiefer; sie erreichen ihr Maximum schon bei 1450 m U. M. Die bedeutend größere Regenarmut übt ihre volle Wirkung aus. Allseitig stimmen die klimatischen und wirtschaftlichen Grenzen Uberein, wo immer die orographische Lage es gestattet; d.h. der Getreidebauer schiebt den Anbau der Körnerfrucht so weit nach oben, als dieselbe eben noch zum Ausreifen gelangt. Der Bündner Oberländer ist durchweg Brot- und Breipflanzer; die Strohgewinnung ist zwar vonnöten, aber meist sekundärer Zweck.
Es muß auffallen, daß auf der Nord- wie Südlage dieser drei Talmulden die Ackerbaugrenzen gleich hoch verlaufen und die oberen Getreidekulturen auch gleichzeitig ausreifen. Infolge der stärkeren Insolation wird doch die Südlage viel früher aper und auch früher bepflanzt! Diesen merkwürdigen Ausgleich ruft der Föhnstrom im Frühjahr und Herbst hervor. Er ist im Verein mit den regenspendenden Westwinden der eigentliche Vater der Fruchtbarkeit des bündnerischen Vorderrheintales. Vom Lukmanier bei Disentis und vom Lungnez bei Ilanz bricht der Föhn herein und staut sich im dazwischenliegenden Graben der drei Talstufen mit natürlich gleich hohen Windstromufern. Auf der sonnigen, längst aperen und bepflanzten Südlage arbeitet er im Frühjahr trocknend und hemmend, hält die Entwicklung der schon Flachs und Hanf und ihre Verarbeitung im Bündner Oberland.
sprossenden Saat etwas zurück, indessen er gleichzeitig auf der schattigen Nordlage die Schneemassen schmelzt und das Gedeihen der eben erfolgten Aussaat fördert; so gleicht er zeitlich auf beiden Talufern aus. Fröhlich und befriedigt wies uns einst ein Obersaxer Bauer der kühlen Nordlage auf die seine und die ebenfalls gleichstehende Ackerflur der reich bepflanzten Südlage hin.
Allein die Bewohner der lichtumfluteten linken Rheinseite haben für ihr „ Vis-à-vis " auf der ausgedehnten Terrasse von Obersaxen doch nur ein mitleidiges Lächeln; sie sind klimatisch weit im Vorsprung. Die Sttdlage ist das gegebene Terrain für den intensiven Kernobstbau, für die schönen Nußbaumkulturen und die Anpflanzung der prächtigen Weizenfrucht. Nicht nur Bart- und weißer Kolbenweizen gedeihen bis ins Disentiser Talbecken vorzüglich; auch der dunkle, rote Kolbenweizen, der „ Carnun " der Romanen, reift meist gut aus; gerade dieser ist die beliebteste Brotfrucht der Südlagen.
Klimatisches Interesse erweckt der einstige Feldbau des Weinstockes in der Ilanzer Talmulde. Derselbe ist längst erloschen. Über seinen Ursprung wissen wir soviel wie nichts; vage Hypothesen haben keinen Wert. Jedenfalls haben die wein-liebenden Römer, die 15 vor Christo Rätien eroberten, die Rebe im benachbarten Churer Rheintal gepflegt. Nach der allgemeinen Christianisierung in der Merovinger-und Frankenzeit des 7., B. und 9. Jahrhunderts mögen die zahlreichen, neu entstandenen Kirchspiele im Bündner Oberland wesentlich zur damaligen Weinkultur beigetragen haben; denn der Naturwein war zur Darbringung des christlichen gottesdienstlichen Opfers durchaus vonnöten; die alten primitiven Einfuhrwege aber boten nicht geringe Hindernisse. Wir finden wirklich solche weinbauende Kirchen im B. Jahrhundert mit Namen angeführt, z.B. Sewis bei Ilanz und Pleif im benachbarten Lungnez. Weinlagen werden bei Sagens, Schleuis, Ilanz, Ruis, Luvis und Pleif erwähnt, also in Höhenlagen von 750, 800, 900, 1000 und 1100 m U. M., wo heute nur noch die früh reifende Spalierrebe bis auf 900 m Höhe spärlich gedeiht.
Gewiß mögen rein wirtschaftliche Änderungen zum Untergang der Bündner Oberländer Weinkultur beigetragen haben, wie noch an vielen anderen Orten; wesentlich aber führen wir denselben auf eine sekundäre Klimaverschlechterung zurück, einzig hervorgerufen durch die anthropogene Beeinflussung; denn der Mensch hat durch die weit um sich greifende Entwaldung des Gebietes, durch die starke Herabsetzung der oberen Waldgrenze schärfere und härtere Klimaextreme in seinem Wohngebiet veranlaßt. Die mittleren Jahresschwankungen der Temperatur wurden erhöht. Dieselben betragen z.B. heute für Basel an der schweizerischen Nordgrenze 19°, für Sitten im Wallis 20.7°, für Schuls im Engadin 21.s°, für Ilanz im Bündner Oberland 21.7°. Die allmähliche Entwaldung verursachte Regenarmut; die Luftfeuchtigkeit wurde herabgemindert — der sogenannte „ Traubenkocher " ging zugrunde.
Die Forstwissenschaft weiß aus Erfahrung, daß zusammenhängende Waldungen ein lokales Seeklima erzeugen, welches mehr ausgeglichene Jahrestemperaturen besitzt. Sie weiß, daß das Klima des Waldlandes um 3 bis 10% feuchter ist als jenes der entwaldeten Gebiete; auch wo Steppen aufgeforstet worden sind, wurden die Felder und Wiesen üppiger. Das einfache Landvolk hat ebenfalls Aug und Sinn für ähnliche Erscheinungen. Wir hörten schon Bauern im Medelsertale sich beklagen, daß die zunehmende stärkere Entwaldung der südlichen Hälfte des Luk- maniers eine der Ursachen sei, weshalb ihr Getreide seither weniger gut ausreife. Die guten Leute bedachten nicht, daß sie und ihre Vorfahren weit größere Sünder in der Entwaldung des eigenen Gebietes waren als ihre ennetbirgischen tessinischen Nachbaren.
Das Bündner Oberland hatte ursprünglich eine obere geschlossene Waldgrenze von 2150 m U. M.; nun ist dieselbe längs der ganzen Linie auf rund 1900 m im Durchschnitt herabgedruckt. Die frühere war die klimatische, die heutige ist nur noch eine wirtschaftliche Grenze. In den einst höheren subalpinen Waldboden schlug und brannte sich der Mensch seine Alpweiden hinein. Die jetzige subalpine Grasflur und Heide sind aus dem Waldgrund längst vergangener Zeiten hervorgegangen; unsere ausgedehnten Alpenrosenfelder stehen ausschließlich auf dem Boden des ursprünglichen Nadelwaldes. Gerade da, wo die geschichtlich ältesten Alpweiden liegen, ist jetzt der Wald fast ganz vernichtet ( Mundaunkette, Alp Quader bei Brigels ). Auch der stehen gebliebene und tiefer gelegene Rest des subalpinen Koniferengürtels ist durch die Schaffung der idyllischen Maiensäße oder Bergheugüter mitten ins Waldbild hinein stark gelichtet.
Die anthropo-zoogene Signatur kommt überall scharf zum Ausdruck. Der Mensch als Alpwirt und Hirt, als Köhler und Bergbauer, dann die Weid- und Wildtiere, die Unfruchtbarkeit des infolge des Weidebetriebes nur zerstreut stehenden alten Bäume haben die Zerstörung und Umformung eingeleitet. Zu ihrer Vollendung halfen endlich Naturkatastrophen aller Arten mit, nachdem der Ansiedler Tür und Tor in den oberen Bergwald geöffnet hatte: Lawinen, Schneedruck, Windwürfe, Steinschläge, Felsstürze, die Arbeit der Gebirgsgewässer und der Atmosphärilien jeder Gattung. Die neu erschlossenen weitschichtigen subalpinen Grasfluren führten ebenso eine sekundäre Klimaverschlechterung für den heutigen Forst- und Weidebetrieb in unseren Alpen herbei.
Doch, gehen wir über zum Völklein des bündnerischen Vorderrheintales. Glücklich hat es seinen Ackerbau noch in die Neuzeit, ohne Staatszwang und ohne Kriegsnot, hinüber gerettet. Manch kluges Weiblein sondert auf dem Tische Körnchen um Körnchen, um ein möglichst wertvolles Saatgut zu erhalten. Noch rutscht im Frühjahr allenthalben das Weibervolk auf der hervorsprossenden Saat, um das Unkraut zu roden; hurtig schwingt es im Spätsommer die Sichel und kniend gräbt es im Herbst die Kartoffeln. Das Mannsvolk überträgt die klein geformten Garben-büschel auf die luftigen Kornhisten. Auf der Tenne tickt und tackt der eigenartige Dreschflegel und Dreschbengel des Mannes und Weibes. Uralte Mahlkonstruktionen haben sich neben den modernsten Mühlen erhalten; auch der Stöpsel im Holzmörser zerstampft noch da und dort das Korn. Zahlreiche kleine freistehende Backöfen, oft überschattet von einem Obstbaum oder in der Nachbarschaft eines idyllischen Kirchleins, hauchen monatlich den frischen Brotduft aus. Noch blinken allenthalben die vielen kleinen Weiher der Hanf- und Flachsrosen, die sogenannten puozs. Schä-kernde Mädchen und ernste Frauen heben das eigenartige Holzschwert zum Lösen der Lein- und Hanffaser ( die spatlunzasnoch immer summt das Spinnrad in der winterlichen Wohnstube und klappert der alte Webstuhl.
Flachs und Hanf und ihre Verarbeitung im Bündner Oberland.
Erster Abschnitt. Von der Faser zum Webstuhl.
1. Kapitel. Geschichte und kulturelle Bedeutung des Flachses.
Uralte Kulturpflanzen der Bündner Oberländer sind Flachs und Hanf.
Der Flachsbau geht weit zurück. Längst vor unserer Zeitrechnung war er im Urbesitz der arischen und indogermanischen Völkerfamilie, also auch der Etrusker, Räter und Kelten. Plinius erzählt ( IV. 121 ), daß die Etrusker linnene Gewänder und ebensolche Panzer trügen. Die Legio linteata der Samniter ( Livius X. 38 ) verkündet, daß auch in Mittelitalien die Flachskultur in Ehren stand. Rom selbst und Süditalien schenkten dem Leinbau wenig Aufmerksamkeit. Ihnen lieferten die gallischen Völkerstämme der Cadurci, Galeti, Ruteni, Bituriges und Morirti ( Plinius XIX. 2. 8. ) die nötigen Leingewebe und Kleider. Deren fertige Leinwandmäntel mit Kapuzen = caracallae, dann das sagum, die palla, culcitra, camisia und bracca wanderten insgesamt nach Rom.
Die gepflanzte Flachsart der Etrusker und Räter war der einjährige Lein = Linum usitatissimum L., wie ihn der Bündner Oberländer heute noch baut. Allein schon die Mumienhüllen der zwölften ägyptischen Dynastie, etwa 3300 Jahre v. Chr., geben dieser Leinart beredtes und vornehmes Zeugnis. Die alten Ägypter führten ihre Linnenerzeug-nisse als Hauptartikel in alle Welt. Auch in Babylonien, Assyrien und Palästina stand die Flachskultur auf hoher Stufe, indes die alten Griechen ihr wieder weniger huldigten.
In den ältesten Pfahlbauten finden wir eine andere Leinart = Linum austriacum. Später trat der römische Winterlein = Linum crepitans auf. Diesen pflanzt heute in Europa noch der Russe und neuerdings in großem Stile der Amerikaner. Als stärkster Produzent der Gegenwart steht obenan Rußland mit den Ostseeprovinzen; ihm folgen Österreich, Holland, Deutschland, Irland, die nordfranzösischen Provinzen und die Flamen in Belgien. Alle dürfte in absehbarer Zeit Nordamerika mit seinem mächtig aufblühenden Leinbau überflügeln.
Die allgemein verbreitete europäische Flachskultur erlebte ihre Glanzzeit im sinnigen Mittelalter. Den schimmernden Leinfaden lockte auf hoher aussichtsreicher Warte jede edle Burgfrau, ebenso gewandt an die rollende Spindel wie das hörige Weib in der armseligen Talhütte. In den französischen Städten bestand damals eine eigene Zunft, die nLiniersu und „ Chattetaciers ", die den rohen Flachs und Hanf außerhalb der Stadt aufkauften, um die Faser zu verarbeiten. Sorgfältig wurde darüber gewacht, daß ja kein Tuch schlechter Qualität das Weichbild der Stadt verlasse. Einfuhrzölle und Abgaben waren genau geregelt.
Die Flachskultur ist heute im Bündner Oberland noch allgemein, trotz des Rückganges des Ackerbaues. Allerdings ist sie in den unteren Stufen des Trunser und Ilanzer Talbeckens auf ein Minimum beschränkt. Die heißen Südhalden von Andest, Waltensburg, Seth, Ruschein, Fellers, dann die tiefen Talmulden um Danis, Ruis, Ilanz, Schleuis, Sagens, Sewis, Kästris, Valendas sind ihr ob der großen Sommerhitze nicht günstig. Der Hanfbau tritt an ihre Stelle. Den stärksten Flachsbau besitzt heute noch das Tavetschertal, dann Medels und Disentis und sämtliche höheren Plateaus der Nord- und Südlage ostwärts bis ins Ilanzer Talbecken, so besonders Brigels und Obersaxen. Der Flachs erreicht allseitig die obere klimatische Grenze. Diese gipfelt im Tavetschertale, oberhalb Tschamut, bei 1720 m ü. M.
Die Flachsscholle ist immer von einjähriger Pflanzdauer. Das System der dreijährigen Ackerzeit im Bündner Oberland weist dem Flachs das erste oder zweite Ackerjahr an. In den wärmeren unteren Talschaften erfolgt die Pflanzung meist im ersten Jahre auf dem Neubruch, der prau dir, um dem Unkraut möglichst vorzubeugen. In den kühleren Hintertälern beliebt dagegen das zweite Ackerjahr, die ruppadira. Überall ist die Tendenz wegleitend, dem aufsprossenden Unkraut zuvorzukommen: Zerclar schuber duasga, ne meglier treisga = Sauber zwei- oder besser dreimal jäten gehört zur Regel. Die Aussaat findet Mitte April statt. Der Flachs verlangt einen mittelschweren fetten Boden. Die vorsichtige Bäuerin sucht sich selbst die passenden Schollenstücke für die Aussaat. Sie macht hier ihre ureigenen Haus-fraurechte geltend, wenn sie das Feld ihres späteren Linnenzeugcs und des geschätzten Speiseöls richtig bestellt wissen will. Mit rührender Liebe hängt sie an ihrem Flachsacker, und Stolz ergreift sie beim Anblick des blaublühenden Feldes. Wie innig Volksseele und Flachspflanze einander verknüpfen, davon zeugt neben vielen Sprüchen, denen wir noch begegnen, auch das sursilvanische Kinderrätsel: Alv engiu, verd ensi e blau sisumLa plonta de glin = Weiß nach unten, grün nach oben und um die Spitze blauDie Leinpflanze.
Auch eine Reihe Wetter- und Ackerregeln berühren das Flachs- und Hanffeld. Selbstverständlich spielt der kindlich ländliche Aberglaube mit, die cardientscha blaua ( blauer Glauben, Dunst ), wie der Sursilvane sich so drollig und bezeichnend ausdrückt. So üben die Bilder der Himmelsgestirne ihren Einfluß auf die Saat aus: 11 glin deig'ins seminar en Vensenna della Stadera, lu peis'el pli Ma = Den Flachs soll man im Zeichen der Waage säen, dann erhält er mehr Gewicht. Und wieder: Sch'ins semna il glin en Venzenna dil Bov, sehe vegn el grobs = Säet man den Flachs im Zeichen des Stieres, so gedeiht er ebenfalls grob. Humor verrät folgende Saatregel: De semnar il glin dovei il semnader star fétg sidrétg, sehe vegni il glin liungs e grads = Beim Säen des Flachses soll der Säe-mann hübsch fein aufrecht stehen, so wird auch der Lein lange und gerade. Gegen den Reiffrost hat der Landmann den guten Spruch: MetV ins ischendra el sem glin, pò la purgina buca noscher = Streue Asche auf die Leinsaat, so vermag der Reif ihr nicht zu schaden. Bei gar vielen dieser alten Regeln vermögen wir heute keine Deutung mehr zu erzielen1 ).
. ' ) Unser romanische Obwaldner bezeichnet den Flachs mit glin. Er ererbte den Namen direkt vom Worte linum seiner lateinischen Sprachmutter, wie auch die übrigen sprachverwandten romanischen Völker. So heißt Flachs französisch = lin; provenc. = Un, li; spanisch = lino, portugiesisch = linho, italienisch = lino, norditalienisch = glin, rumänisch = in usw.
Die Frage, ob die Namen des Leins, griechisch = hvov, keltisch-kymrisch = lin, alt-irisch = lin, gotisch = lein, altkirchen-slavisch = linn, lateinisch = linum, urverwandt sind oder auf Entlehnung beruhen, scheint heute zugunsten der ersteren Annahme entschieden.
Wir entnehmen manche terminologischen und historischen Notizen der klassischen Arbeit von Dr. W. Gerig: Die Terminologie der Hanf-und Flachskultur in den franco-provenzalischen Mundarten in: Kulturhistorische Zeitschrift für Sprach- und Sachforschung. Beiheft 1, Heidelberg 1913. Carl Winters Universitätsbuchhandlung, Verlagsnummer 919.
Flachs und Hanf und ihre Verarbeitung im Bündner Oberland.
2. Kapitel Geschichte und kulturelle Bedeutung des Hanfes.
Die Urheimat des Hanfes dürfte wohl Zentralasien oder das südliche Rußland, das alte Skythien, sein. Aus Ostindien kennen wir eine Hanfart schon 900 Jahre vor Christo. Sie wurde als Genußmittel gezogen. Aus ihren Deck- und Blütenblättern erhielt man ein narkotisch wirkendes Harz. Die Orientalen bereiten daraus den berauschenden Haschisch, ebenso einen Ersatz für Kau- und Rauchtabak. Denken wir nur an die betäubenden ätherischen Öle, die auch unseren Hanfstauden entströmen! Herodot erzählt uns, wie die Skythen den Samen des Hanfes bei ihren Totenbestattungen zur Reinigung verwendet und sich daran berauscht hätten. Dagegen war der Hanf dem semitisch-ägyptischen Kulturkreis des Altertums völlig fremd. Auch die Griechen kannten ihn zu Herodots Zeit noch nicht, während er in Thrazien und im südlichen Rußland allgemein gebaut wurde. So drang die Hanfkultur ost-westwärts wahrscheinlich im 4. und 5. Jahrhundert vor Chr. zu den Germanen vor und wanderte von Stamm zu Stamm. Die nordischen Naturvölker verwendeten die Hanffaser vorzüglich zur Bereitung starker Gewebe. Diese grobe Faser der „ Barbaren " mag aber die Kulturvölker des Südens, die Ägypter, Griechen und Römer lange Zeit wenig angelockt haben, bis die erhöhte technische Verwendbarkeit auch sie zum Anbau des Hanfes anregte. Plinius bezeugt uns bereits blühende Hanf-kulturen Italiens. Jedenfalls aber haben die Etrusker und Ritter längst vorher den Hanf als ein Erbstück ihrer nordischen und östlichen Stammesverwandten gekannt. Aber selbst im späteren Mittelalter, der Blütezeit im Aufschwung der Hanfpflege, blieb die hänfene „ Leinwand " das Tuch der einfachen ärmeren Leute. Erst die letzten Jahrhunderte haben dem Hanf den mächtigen Vorsprung über den Flachs gebracht. Vielfach und vielenorts erlag der Flachs völlig der Konkurrenz des Hanfes. Rußland deckt heute fast ganz den europäischen Markt der Hanffaser oder füllt wenigstens die Lücken aus, wo die Hanfkultur noch im bescheideneren Maße zu Hause ist, so besonders in Italien um Bologna, im südlichen und östlichen Frankreich, in Deutschland und Österreich. Die schweizerische Milchwirtschaft hat heute dem einst blühenden einheimischen Hanf- und Flachsbau großenteils den Boden geraubt. Bescheidene Zufluchtsstätten, sogenannte Refugien, finden wir meist noch in den zentralalpinen Tälern. Auch unsere französische Westschweiz hat das alte Erbe der burgundischen Königin Berta zum Teil pietätsvoll bewahrt, so besonders die Waadt und Freiburg.
Der Haushalt im Flachs- und Hanffeld hat teils große Übereinstimmung, aber auch Verschiedenheiten. Der Hanf verlangt längere Entwicklungszeit, besonders höhere Sommertemperaturen. Diese erhält er im Bündner Oberland nur in den warmen Talbecken von Ilanz und Truns und ihren Seitengehängen. Seine obere Grenze liegt auf der Südlage bei 1200 m in Andest und auf der Nordlage bei 1140 m in Flond. Die kleine warme Wiesenmulde bei Disla-Disentis ( 1050 m ) erlaubt dem Hanf noch ein klimatisch bevorzugtes Plätzchen im äußersten Westen. Alle übrigen Angaben über seine Verbreitung im hinteren Disentiser Talboden, im Medelser- und Tavetschertal in Reisehandbüchern usw. sind irreführend. Es kommt nicht in Betracht, wenn etwa ein neugieriges Frauchen der hinteren westlichen Talschaften von einem Besuch aus den unteren Talstufen den interessanten Hanfsamen mit nach Hause schleppt. Es macht eine Versuchsanpflanzung, meist auf dem alten Lägerplatz eines Dungstockes des vorigen Jahres, den ihr der gestrenge Eheherr nicht streitig macht. Wir haben dies mehrmals persönlich festgestellt. Der erste Kulturversuch hört mit der Befriedigung der an sich schätzenswerten Neugierde der Bäuerin wieder auf, denn das Klima setzt seine unerbittlichen Schranken.
Wir bedauern den quantitativ starken Rückgang der Hanfpflanzungen im zentralen Bündner Oberland. Die horizontale Verbreitung innerhalb der vorhin genannten klimatischen Grenzen ist aber noch in kontinuierlicher Folge vom unteren Disentiser Talboden ostwärts über Rabius, Truns, Schlans, Danis, Ruis, Ilanz, Kästris, Valendas, Sagens, Fellers, Laax, Flims, Trins, bis ins Churer Rheintal. Der eine und andere Hanfacker fehlt innerhalb dieser Längsachse heute wohl keiner Ortschaft und keinem Weiler. Wir ersparen uns die Aufzählung aller Ortsnamen. Relativ stärkeren Hanfbau beobachten wir in Andest und Flond.
Der Hanf ist befähigt, eine Reihe von Jahren auf der gleichen Scholle zu gedeihen. Diese Eigenschaft verschafft ihm gegenwärtig in Europa seinen Sieg über den Flachs, denn der Lein vermag erst nach 6 — 7 Jahren Unterbruch wieder in der gleichen Ackerkrume aufzukommen. Die rationellen Oberländer Bauern benutzen aber ihre drei- beziehungsweise auch zweijährige Ackerzeit ganz für den Hanfbau auf der gleichen Scholle. Nach ihren Erfahrungen wollen nach der Hanf kultur weder Weizen, noch Roggen, noch Kartoffeln ersprießlich gedeihen. Auch das erste Wiesenjahr ergebe auf dem alten Hanfacker nur eine wenig begehrte Heuqualität.
Der zukünftige Hanf acker soll weiche, fette, eher etwas feuchte Erde besitzen. Wo diese fehlt, z.B. im sandigen Rheinauengebiet, wird durch starke Düngung nachgeholfen ( in Ruis ). Die Aussaat des Hanfes erfolgt Mitte April und darf weder zu dicht noch zu locker ausfallen. In letzterem Falle fürchtet die Bäuerin die Entwicklung allzu grober und dicker Hanf stengel. Ferner scheut sie das Spatzenvolk sehr, das ihr die Samen wegstiehlt. Sie wirft deshalb viel Getreidespreu oder Schrotstroh aus, oder auch lockeren, feinen, teockenen Schafdung zum Bedecken der Saatfläche ( in Andest und Ruis ).
Einer Sorge und Mühe ist die Hausfrau enthoben: sie braucht auf dem Hanffeld nicht zu jäten. Die zerbrechlichen, aufsprossenden Stauden erlauben kein Betreten des Hanfackers. Das Begehen desselben ist allgemein bis zur Stengelreife verpönt. Der junge Hanf duldet übrigens wenige Konkurrenten und raubt ihnen bald Luft, Licht und Platz. Sein Plagegeist ist höchstens die schmarotzende Kleeseide ( Cuscuta ).
Droht im August vor dem Raufen der Stengel ein unerwarteter Schneefall, so eilen die Bauern mit langen Latten zum Hanffeld und legen mit deren Hülfe den schönen, grünen Stengelwald nieder. Der „ böse " Schnee stößt und legt sich nur auf eine glatt gelegte Fläche. Keinen der dünnen Stengel vermag er noch zu knicken. Bleibt er vorübergehend auch einige Zeit sitzen, so ist die Bäuerin doch getröstet; denn er verkürzt nur die nachfolgende nötige Wasser- und Rasenröste ihres Hanfes ( siehe unten ).
Unser Sursilvane hat weder für den Hanf- noch Flachsacker ein eigenes Wort. Er sagt kurzweg: prau oder er de conniv ( Hanffeld, Hanfacker ) oder de glin ( Flachs ). Dagegen benennt der Bewohner des romanischen Albulagebietes das Hanffeld mit tschanvèr. Hanf bezeichnet der romanische Obwaldner kollektiv mit Conniv; der Albulabewohner sagt tschovan, das durch Metathese aus Conniv entstanden ist1 ).
Flachs und Hanf und ihre Verarbeitung im Bündner Oberland.
3. Kapitel. Das Raufen des Hanfes.
Die Ernte des männlichen Hanfes findet in der ersten Hälfte des Monats August statt, jene des weiblichen oder Samenhanfes gegen Ende September, z.B. im tief gelegenen warmen Ruis zwischen dem 20. und 25. September. Der Hanf wird stehend gezogen = gerauft. Vor dem ersehnten Raufen des Fimmels wünscht sich die Bäuerin: Avon che trer funiala ( femniala ) sto ins schar pigliar treis rugadas d' Uost = Bevor man den Fimmel rauft, möge ihn der Tau der ersten Augusttage dreimal benetzen.
Gleich vielen anderen Völkern bezeichnet der Sursilvane den männlichen Hanf mit dem weiblichen Geschlechtsnamen = femniala, femniala, funiala, wohl auch mit femala, famala. Der Bewohner des Albulatales spricht ähnlich femneala. Die in einigen Volkssprachen fast humoristisch wirkende Geschlechtsverwechslung in der Bezeichnung des männlichen und weiblichen Hanfes ist nicht völlig aufgeklärt. Die Hanfpflanze ( Cannabis saliva L ) ist zweihäusig. Die deutsche Schriftsprache kennt ebenfalls das Wort „ Fimmel ", „ Femel ", für den männlichen Hanf1 ).
Der urchige Schweizerdeutsche Volkswitz hat für den Fimmel jedenfalls eine zutreffende Bezeichnung; er nennt ihn „ Hanfnaretauber Hanf. Hat er doch ganze Völker genarrt! Gut ist auch der schweizerdeutsche Ausdruck „ Bästlig "; denn von ihm, dem Fimmel, erhält die Hausfrau die gesuchte feine Bastfaser.
Konsequent bezeichnet der Deutsche den weiblichen Hanf nun „ Mastel " ( lateinisches Lehnwort ) Q ). Dem Sursilvanen fehlt dieser Name, obschon sein mas-chel = männlich bedeutet. Wir fanden bei jeder sorgfältiger Nachfrage für den weiblichen Hanf immer nur die Bezeichnung vor. Die deutsche Schrift- sprache gebraucht heute für die Benennung der weiblichen Pflanze ebenfalls das Wort „ Hanf. Der Schweizerdeutsche hat aber wieder das lateinische Lehnwort „ Mäschel ".
Will unser Bänder Oberländer ein lang gewachsenes, schmächtiges Menschenkind foppen, so beehrt er es mit der Auszeichnung: Satel sco in conniv = dünn wie ein Hanfstengel.
4. Kapitel. Das Raufen des Flachses.
Auch die reifen Flachsstengel werden gerauft, d.h. gezogen ( trer il-glin ). Das Flachsraufen fällt meist in den Monat August. Die Frauen tragen ihr buntes Kopftuch. Die Mädchen schlingen oft kokett eine weiße Kopfbinde um ihr Haar. So finden wir sie auf dem Flachsacker. Rundum sind diese Äcker zwischen die wogenden Roggen- und Gerstenfelder eingestreut. Vorab helfen schwesterlich einander die cummars. Eigentlich bedeutet la cummar die Gevatterin mit dem innigen Verhältnis, das sich zwischen Kindsmutter und Patin herausgebildet hat; sodann dehnt sich der Begriff auf die gesamte befreundete „ Basenschaft " aus. Gleich nach dem Stengel- raufen erfolgt auf dem weiten sonnigen Plan das Riffeln der Flachskapseln ( siehe unten: Leinsamen und Öltorkel ).
Die gerauften Flachsbündel legt die emsige Arbeiterin abseits. Männerhände sammeln und binden sie zu stattlichen Garben, den monas, mit Hülfe elastischer Weidenruten von den benachbarten, überall eingestreuten Mttschna-Jlügeln. Das sind strauchbewachsene Steinhaufen mitten im Kulturland. Sie hat einst der Bauer zusammengelegt, als er das Feld von Steinen und Felsstücken säuberte. Alle Strauch-hölzer der Umgebung aber besetzten diesen neuen Standort für einen passenden und sicheren Haushalt.
5. Kapitel. Die Wasserröste Ton Flachs und Hanf.
Die Flachs- und Hanfgarben wandern nun zu den Flachsrosen, d.h. den Röst-oder Rottgruben. Meist in der Nähe der Weiler, oft auch abseits in einer Wiesenmulde, wo ein Wässerlein sich durchschlängelt, oder längs der Gießen und Alt-wässer des jungen Rheines blinken diese Wassertümpel und kleinen Teiche. Es sind immer mehrere beisammen. Eine interessante Sumpfflora umrahmt und besiedelt dieselben, die Puozs, wie der Sursilvane sie heißt. Alle sind gegraben, meist metertief und darüber. Oft beobachten wir auch verlassene und durch die Sumpfflora ver-landete Röstgrubenx ). Sie geben da und dort zur Bildung von Flurnamen Veranlassung, z.B. bei Ruis und Sedrun und wohl noch anderwärts. Der Name dieser Orte „ ils puozsu ist geblieben, die Röstgruben selbst sind längst verschwunden und wurden an andere Stellen verlegt.
Der Oberländer setzt immer die grünen frischen Hanf- und Flachsgarben unter Wasser ( surselv. puzzar ). Jene, weil schwer, sind von geringem Umfange; zwei Handbüschel ( brauncas ) bilden bereits eine mona Hanf; 10 monas ergeben eine scheina ( lat. decem ). Die Hanf rose wird mit etwa 10 scheinas belegt. Die Reim-worte: pintga braunca, pintga mona = kleines Handbüschel, kleine Garbe, bezeichnen dem Sursilvanen den geringen Erfolg wegen zu geringer Hülfsmittel und Fähigkeiten.
Der Flachsbauer aber legt sich eine stattliche, umfangreiche mona oder Flachs-garbe an und beschickt die Röstgrube, je nach ihrer Größe, mit 15 bis 20 Stück.
Flachs und Hanf und ihre Verarbeitung im Bündner Oberland.
Bretter mit beschwerenden Steinen halten die Bündel unter Wasser. Ausgehobene Erdschollen erhöhen rundum die Ränder der Grube, damit ja die Wasserfläche die unten liegenden Bündel gut bedecke.
Die Wassergrube sowohl wie der Tau und Regen der nachfolgenden Rasenrotte sollen Flachs- und Hanfstengel zermürben und den erhofften Bast im beginnenden Fäulnis- und Verrottungsprozeß zum leichten Ablösen bringen. Man zieht weiches und warmes Wasser jedem anderen in der Röstgrube vor. Sie wird daher, wo möglich, auf stagnierenden, sonnigen Bodenflächen angelegt. Der silikatreiche, kalkarme Untergrund des Gebietes begünstigt die Anlagen. Vorsichtig beobachtet die Hausfrau den Wärmegrad des Röstwassers, mindert oder verstopft zeitweise die Zuleitung, um die Wassertemperatur zu erhöhen, sorgt aber, daß die Flüssigkeit des Röstbeckens selbst nicht in Fäulnis übergehe. Das kältere und härtere Rheinwasser im Auengebiet erfordert eine längere Röstzeit. Für den dünnen Hanffimmel genügen normal 10 Tage; der robustere weibliche Hanf erfordert 3 Wochen. Der Flachs im weichen Wasser bedarf gleichfalls 10 Tage, im kalten und harten aber bis 20 Tage Röstzeit. Die Frauenhand macht von Zeit zu Zeit Prüfungsversuche. Bricht der Hanfstengel beim Umbiegen leicht, so naht das Ende seiner Wasserröste. Löst sich ebenfalls der Flachsbast zwischen den reibenden Fingerballen, so darf auch er dem dumpfigen Wasser enthoben werden. Immer wird etwas Zeit zugemessen.
6. Kapitel. Die Rasenröste des Flachses.
Das Entheben der Flachsgarben aus den Gruben erfordert zwei Männerkräfte. Die wasserschwere Masse wird ein bis zwei Tage neben den Feldgruben zum Abtropfen aufgestellt und öfters mit Leintüchern bedeckt. So vorbereitet, unterliegt der Flachs vorerst der folgenden Rasenröste, der stemnada der Sursilvanen.
Das hügelige Gebiet bedingt meist die Auswahl sanft geneigter Wiesenflächen für die Taurotte des Flachses, wo kurz vorher der Emdschnitt stattgefunden hat. Neuerdings setzt die gegenseitige Hülfeleistung der befreundeten cummars ein. In langen dünnen Bahnen legen sie Reihen an Reihen ( stemnas glin ) Flachsstengel auf die glatte Rasenflur ( sterminar, stemnar ). Am Anfangspunkt der obersten Reihe, wo das Setzen begonnen hat, und am Schlußende der untersten flechten sie eine Handvoll Stengel in Kreuzesform, um ihr wertvolles Gut unter den Schutz des christlichen Zeichens zu stellen.
Eine biala stemna glin erfüllt jede Bäuerin mit eifersüchtiger Freude. Lieb ist den Frauen, wenn der ausgebreitete Flachs erst sich trocken legt, dann Regen und Tau dreimal ihn befeuchten. Doch soll die Taurotte in 8-10 Tagen vollendet sein. So erhoffen sie eine helle, goldene Flachsfaser; darauf sind sie mehr erpicht als auf ein weißes Brot auf dem Tisch. Das Unheil verfolgt sie wohl hie und da. So im Oktober 1917, wo ein allzufrüher Schneefall viele stemnas im Tavetschertale eingedeckt hatte. Der im Freien auf dem bloßen Boden ausgebreitete und schneebedeckte Flachs ist verloren, wenn er dort über den ganzen Winter verbleiben muß. Die Erde zerfrißt die Faser. Im Februar 1918 betraten wir im Tavetsch eine Stube, wo Mutter und Tochter am Spinnrad saßen und ein auffallend graugrüner Rocken uns grüßte. Auf unser Befragen erfuhren wir, daß der vorhin erwähnte Schneefall den Flachs glücklicherweise noch in der Flachsrose ( Wasserröste ) erwischt hatte. Die Rasenröste fiel somit aus; daher die eigenartige Färbung der Gespinnstf aser im Gegensatz zu den normalen, beliebten falb-blonden, gleißenden Flachssträhnen. Eine flachs- und hanfbauende Bäuerin aus Rabius, im Trunser Talbecken, bemerkte uns: Das „ puzsar glin ne connivu, das Wasserrösten von Flachs und Hanf unterlasse sie dann, wenn die Stengel durch vorzeitigen Schneefall oder schwere Regengüsse im August gelitten hätten und die Wasserröste nicht mehr ertrügen. Allein nach der allgemeinen Regel vereinigt der Bündner Oberländer die Wasser-und Rasenrotte. Auf jedes Befragen an allen Orten erwidert uns die Hausfrau: Wir erhalten durch die Doppelröste eine hellere Flachs- und Hanffaser; wir lieben aber das feinere, weiße Linnen für Bettzeug und Hemden.
Ist die Rasenröste des Flachses vollendet, so sammelt die Bäuerin die ausgelegten Flachsstengel mit dem Rechen zu kleinen Häufchen, den nuorsas de glin ( Flachsschäfchen ). Der Tavetscher bezeichnet die Arbeit mit far nuorsas = Schäfchen-machen. Der Vergleich ist klassisch und für unser sinniges Bergvölklein charakteristisch. Die „ Flachsschäflein " geben ihm das ersehnte Linnen; seine zahlreichen lebenden echten Schäfchen das ebenso begehrte Lodenzeug. Die Bündel der nuorsas de glin werden zu den Ställen getragen und dann zum völligen Austrocknen längs der Stallwände aufgestellt.
Das ganze Alpengebiet, von den französischen Basses Alpes bis zu den Julischen Alpen Österreichs, viele Gegenden Spaniens, Italiens, Frankreichs und Belgiens besitzen die Wasserrotte. Allein schon vor Jahrhunderten hatten französische Städte ihren Bauern streng untersagt, die Flüsse zum Rösten zu verwenden, weil das Wasser verpestet würde und die Fische darin stürben !). Die alten Ägypter gaben der reinen Rasenröste den Vorzug. Wir treffen sie heute im Osten und Süden Frankreichs, fast überall in der Westschweiz, mit Ausnahme des Wallis, ferner in Holland, wo der ausgebreitete Flachs alle paar Tage mit Meerwasser Übergossen wird. Im Elsaß findet man zum Teil die Winterlandsröste, bei der die Stengelreihen dem Schnee aufliegen. Die Fasern lösen sich auf rein mechanischem Wege durch Einfrieren und Auftauen, nicht aber durch den Vorgang der Zermürbung.
7. Kapitel. Die Haus- und Felddarre der Hanfstengel.
Die der Röstgrube entnommenen Hanfstengel machen alsdann die Haus- und Scheunendarre durch, gleich wie im Wallis, in gewissen Teilen der deutschen und französischen Schweiz. Längs der Häuser- und Scheunenfronten, auf deren Vordächern und Gesimsen stehen die Stengel aufrecht angelehnt, um im föhndurchwehten, herbstlichen Alpentale von Sonne und Wind gut getrocknet zu werden. Seltener beobachten wir die Felddarre, weil die Hanfkultur auf ein Mindestmaß herabgesunken ist. Der Bauer errichtet auf kreuzweis gestellten Pfählen ein einfaches Latten-gerüst in der Nähe der Weiler, und Frauenhände reihen die Hanfstengel in wechselnder Kreuzstellung längs der Lattenzeilen ( las caddnas ). Es war uns nicht möglich, eine besondere Bezeichnung für die Arbeit zu erfragen. Wir sahen solche Hanf- Flachs und Hanf und ihre Verarbeitung im Bündner Oberland.
hecken in Rabius, Ruis, Flond und Schleuis. Der Bewohner der Albula nennt die Hanfgehege tschadeinas.
An den heißen Südhalden von Andest wird der wassergeröstete Hanf erst einen Tag zum Abtropfen an Haufen gelegt, dann in Reihen ( rètschas ) auf 2-3 Tage ausgebreitet, damit die Stengel, trocknen. Männerschultern tragen die abermals gesammelten Bündel zu den Getreide- talinas der Stallfronten und stellen sie aufrecht an die Gerüste oder auf die heufreien oberen Böden der Ställe. Hier verharren die Bündel bis zur Zeit des Schleizens, das gegen Ende Oktober beginnt.
8. Kapitel.
Das „ Schleizen " und Brechen des Hanfes.
Naht diese Zeit heran, so prüft das kritische Auge der Bäuerin sämtliche Hanfstengel. Die schlanken und wohlerhaltenen haben die Ehre, der „ schleizenden " Hand der Mädchen und Frauen persönlich den Bast abzugeben. Die übrigen wandern zum Häuflein jener, denen die klappernde Breche den Leib quetscht und den Bast entfernt. So in Ruis, Danis, Andest und Flond. Anderswo verfällt jeder Hanf der Breche, z.B. Rabius, Truns, Schlans. Fast jeder Ort hat seine eigene Art und Weise und die Familien selbst ihre Varianten. Ausschlaggebend ist jeweils die Hausmutter.
Unsere älteren Frauen geben dem „ Schleizen " ( sursilv.stigliar)l ) des Hanfes weitaus den Vorzug. Nach ihrer Ansicht erhält sich die Faser besser, zerreißt nicht und erzeugt weniger Abwerg. Leider verliert sich dieser altehrwürdige Brauch der Väter immer mehr, wie die Kultur des Hanfes selbst. Der Brechstuhl gewinnt eher an Boden, weil die jungen „ Schönen " das schwierigere Schleizen nicht mehr gerne erlernen. Die gleiche Beobachtung machen wir in der deutschen und französischen Schweiz. Dagegen behalten zahlreiche Provinzen Frankreichs die alte Tradition des Schleizens bei, so: Dauphiné, Savoyen, Lyonnais, Bourbonnais, Bourgogne, Centre, Champagne und Baße-Bretagne, dann zum Teil Elsaß und Flandern, Piémont und Spanien. Vorerst schildern wir eine „ Schleizete " im Bündner Oberland ( Tafelfig. 1 ).
9. Kapitel.
Die „ Schleiz-Stubete " von Andest.
Sursilvanisch: II stegl.
Als „ steig " bezeichnet der Sursilvane die Versammlung oder Gesellschaft der Schleizerinnen ( stigliunzas ). Wir bringen ein wahres Bildchen der Gegenwart aus dem sonnig gelegenen Dörfchen Andest im zentralen Bündner Oberland.
Ein Freudenfest ist 's, ein ersehntes, für die erwachsene Jugend! Schon eine Woche vorher wird bekannt, daß in einer Familie der „ Steig " stattfinde. Noch am gleichen Abend soll ihr gesamter Hanf geschleizt werden. Dazu braucht es aber viele Mädchenhände. Noch einmal trocknen sich die monas, d.h. dünne Hanfgarben, am erwärmten Ofen gut aus. So geht das Schleizen leichter. Alle Mädchen der Nachbarschaft treten in die trauliche Wohnstube, soviel sie ihrer faßt. Jede Arbeiterin legt sich die erste mona quer auf den Stuhl und schiebt sie der Sessellehne zu. So kommt die Hanf Jungfer halb auf das Stuhlbrett, halb auf das Stengelbündel zu sitzen. Sie holt jeweils sich ein Büschel von 5—8 Stengeln aus ihrer halben Verborgenheit hervor und legt sie mit den Wurzelenden nach oben in die rechte Hohlhand. Mit Daumen- und Zeigefingern faßt sie jeden Einzelnstengel und bricht ihn etwa 30 cm vom Wurzelende entfernt kräftig das erstemal durch. Die Rohfaser ( la teglia ) tritt sogleich an der Bruchstelle hervor. Der Mittelfinger der linken Hand krümmt sich alsdann zum Haken und erfaßt die Fasern so, daß sie in der entstandenen Pingeröse gleiten. Unter kräftigem Ruck werden Finger und Arm nach links gezogen, indessen Daumen und Zeigefinger der Rechten den noch nicht gebrochenen Stengelteil festhalten. Das gebrochene Holzstengelstück schlaudert zu Boden. So bricht und schleizt die stigliunsa ruckweise jeden Stengel drei- bis viermal. Spürt eine gewandte Schleizerin, daß schon beim ersten Zug der Bast am ganzen Stengel sich lösen will, so befreit sie, den Arm weit ausholend, die Faser auf einmal von der ganzen Stengellänge. Sie ist ökonomisch genug, nachzuprüfen, ob ja jede Faser gewonnen sei. Die geschleizten Fasern hält sie zwischen dem Mittel- und kleinen Finger der Linken solange fest, als die halbe Hohlhand zu fassen vermag und flicht das kleine Bündel sogleich zu einer provisorischen poppa teglia de conniv = Hanfzopf ' ). Sie legt diese an Haufen und unterwirft sie später dem Bleuen und Schwingen. Siehe unten!
Die Hausfrau hat unterdessen einige Viertel frischer, saftiger Birnen bereitgestellt und verteilt sie unter die arbeitenden Mädchen. Da in Andest gute Birnen nicht mehr reifen ( 1180 m ü. M. ), so hat sie selbe im benachbarten milderen tieferen Waltensburg oder Ruis gekauft. Noch andere Gäste nehmen Aufstellung an der Türe der Schleizstube, ohne sie zu betreten. Es sind die mats oder Jünglinge. Offiziell eingeladen wurden sie nicht, aber sie kommen ganz von selbst. Einer von ihnen hüllt sich in ein weißes Linnen, betritt vermummt die Stube und erbittet von jeder Schleizerin sich eine Birne. Diese Gaben verteilt er draußen an die harrenden Genossen, die nun insgesamt die Schleizstube betreten dürfen. Ein jeder nimmt Platz zwischen zwei Mädchen, zieht die Hanfgarben an sich, stellt sie zwischen seine Beine und verteilt die Stengelbüschel nach rechts und links artig an die schleizenden „ Schönen ". Man plaudert, schäkert und neckt. Die Arbeit wird auf Mitternacht meist vollendet.
Es folgt der „ puschegn " der Sursilvanen. Abermals verlassen die Jünglinge die Schleizstube. Geschäftige weibliche Hände räumen sie von den Stengelabfällen; doch haben die Hausfrau und ihre dienstbaren Geister die liebe Not, zu verhüten, daß nicht die Burschen den Milchkaffee und die Süßigkeiten versalzen, die den Flachs und Hanf und ihre Verarbeitung im Bündner Oberland.
emsigen Arbeiterinnen als Lohn warten. Butter, Honig und Käse, Bündner Bindenfleisch, Birnbrot und tuargia, d.h. süßer Hollunder- oder Himbeersaft und wie die guten Oberländer Dingerchen alle heißen, belohnen Arbeit und das weibliche „ Zieren ". Selbst ein Gläschen „ Enziangeist " stiften die „ mat$u ihren zukünftigen „ spusas ", die schließlich alle davon nippen. Doch sie selbst rauchen draußen in der Hausflur oder im mondhellen Freien ihr Pfeifchen, ohne Alkohol und Kaffee, im bündnerischen Phlegma, bis zu „ guter Letzt " ein anständiges Tänzchen den „ Stegl " beschließt. Das Auge der Ortspolizei und des Volkes sind da „ eins.
Familien, welche die Kosten ersparen müssen oder wollen, schleizen allein und wohl auch während des Tages vor der Hausflur oder im dämmerigen Stall und Tenne.Viele andere Arbeiten verschieben das Schleizen bis in den Februar. Wir sahen im Februar 1918 in Ruis und Waltensburg noch viele Fimmelgarben längs der luftigen „ Talinas " ungeschleizt stehen. In der heutigen Kriegszeit und Landes-not haben die guten Leute dem feierlichen Schleizen doch nicht ganz entsagt. Sie sind ja Selbstproduzenten ihrer Lebensbedürfnisse und liefern nebenbei den Überschuß ihrer Produkte gleichmütig an die Zentralstellen, wenn auch in kluger bäuerlicher Vorsicht und Berechnung.
10. Kapitel.
Der Brechstuhl.
Sursilvanisch: La braha.
Unser Bündner Oberländer hat die Hanfbrechmaschine jedenfalls erst in später Zeit vom unteren Rheintal beziehungsweise von Süddeutschland her eingeschleppt. Die Breche oder Bracke erspart mehr Zeit und Arbeitskräfte als das ursprüngliche Schleizen. In den Grundzügen hat der Oberländer den dreifugigen Typ einer mittelschweren Breche, wie die deutsche und französische Schweiz, Frankreich und Italien ( Textfig. 2 ). Mancher Leser wird sich noch der „ Ratsche " aus seinen Jugendjahren erinnern. Auf einem Holzgestell ( „ Bock " ) sind vier glatt gehobelte, harthölzerne Bretter in Kantenstellung und in einem Abstande von etwa drei Zentimeter zueinander parallel in der Längsachse festgefügt. Nach dem Prinzip des einarmigen Hebels werden drei ebenso geformte und unter sich verbundene Bretter von oben her zwischen die offenen Fugen der unteren schlagweise geführt. Sie arbeiten zu einander wie kombinierte Kinnladen. Die Führung am Hebelgrunde besorgt ein Querbolzen in Holzösen. Sämtliche Bretter einer jeden Kinnlade sind an der Oberländer Breche unter sich festgefügt und unbeweglich. Zwischen diese „ Kiefer " wird je ein Hanfbüschel geschleudert und ruckweise gequetscht. Im Bündner Oberlande bestehen die Kinnladenbretter oft aus dunkelm Eichen- oder Nußbaumholz, weil beide Baumarten häufig auftreten und dem Tischler leichter zur Hand sind als das spärlich im Koni-ferenbestand eingestreute Buchenholz.
Die deutsche und französisch-schweizerische Breche ruht auf vier hohen spreizenden Holzfüßen. Die Arbeiterin führt daher den beweglichen oberen Hebelarm an vorgestellter Handhabe aufrecht stehend. Im Bündner Oberland begegnen wir dieser f P, Dr. Karl Hager.
Konstruktion seltener. Seine Breche besitzt nur vier kurze Beine. Der hintere Quer-bock verlängert sich nach links zu einem schmalen Sitzbrett zweifelhafter Bequemlichkeit. Auf ihm sitzt die Arbeiterin. Die Breche steht ihr also zur Rechten und ist entsprechend kurz gebaut. Ein Holzklotz an der Stirne des Hebels gibt die nötige Schwungkraft bei seinem Heben und Senken. Ein hölzerner Haken, Ring oder Horn oben auf dem maßigen Stirnklotz dient der Arbeiterin als Handhabe. Köstlich und treffend umschreibt das sursilvanische Kinderrätsel die Oberländer Breche:
Quater combos senza schanugl; siat costas buca dad ies; in tgau sco in mogn ed in tgiern en la MonaLa braha Vier Beine ohne Knie; sieben Rippen, doch nicht aus Gebein; ein Kopf wie ein junger Stier ( Mutschund ein Horn im NackenDie Breche —.
Mit der Linken schleudert die Brecherin jeweils ein Hanfbüschel quer auf die unteren Kinnladen der Breche, indes die Rechte den schweren Hebel führt. Uns schien die Arbeit ermüdend zu wirken. Doch verlieren die Mädchen weder Humor noch Sprache, und bündnerische Jugendkraft kommt ihnen vollauf zugute ( siehe Tafelfig. 3 ). Sonnenver-brämt gleich ihrem goldig braunen Haus und Heim und sehnig- geworden durch die lange, beschwerliche, sommerliche Heu- und Emdernte. zu Berg und Tal, machen sie sich aus dieser Arbeit ein Vergnügen, und die helle Freude lacht aus Gesicht und Augen, wenn erst noch der Lichtbildner sie auf seine Platte zu bannen versucht. Wie beim Schleizen, so flicht auch nach dem Brechen die Arbeiterin sich ihren ersten grobfaserigen Hanfzopf, die uns bekannte poppa teglia de conniv.
Das Hanfbrechen geschieht bald gruppenweise, meist aber in stiller Verborgenheit in einem Winkel der Häuser und Ställe oder Fig. 2.
längs der schmalen Dorfgassen, die regelrecht fruchtschwere Hollunderbäume zieren. Wir entnahmen das Bildchen einer „ Brechete " im Dörfchen Tavanasa ( Fig. 3 ). Das Brechen besitzt aber nicht jene ursprüngliche Volkstümlichkeit wie das Schleizen des Hanfes und das Schwingen des Flachses ( siehe unten ). Trotzdem ersetzt das ,,braharul ) langsam das „ stigliar ".
Flachs und Hanf und ihre Verarbeitung im Bündner Oberland.
Der Sursilvane überträgt den Lärm der Breche auf die Redensarten: Quel fa ina braha = er macht viel Lärm, ist ein Vielschwätzer; wieder: Quel brah'adina = er ist ein unruhiger Mensch und beschäftigt sich mit vielerlei.
Die verholzten Stengelrückstände des Schleizens und Brechens heißen farcaglia. Viele Landwirte verbrennen sie. Rationelle Bauern aber zerquetschen sie erst noch mit dem Dreschhengel, verwenden sie als Stallstreue und dann als wertvolles Dung-stroh. Die porösen Stengelteile, sagen sie, saugen viel Jauche ein, die auf der Scholle wieder zur Geltung komme. Manche Bäuerinnen gebrauchen die Stengelabfälle zum Anfeuern im häuslichen Herd, weil sie sich leicht entzünden.
11. Kapitel. Das Bleuen, Pochen und Schwingen des Hanfes.
Die beim Schleizen und Brechen gewonnenen und provisorisch geflochtenen poppas teglia = Zöpfe werden abermals geöffnet, einzeln der Länge nach gedreht und 8 bis 10 Stück nebeneinander gelegt. Zwei Frauen, von denen die eine sitzt, die andere steht, erfassen sie gemeinsam an den Enden, winden und drehen sie fest ineinander und formen sie durch Bildung einer Schleife zu einem dicken, rundlichen, kranzförmigen Wulst, dem mglzugl ) oder zul de conniv. Die zuls harren oft wochenlang, bis die Frauenhand sie abermals in Angriff nimmt, um sie erst zu bleuen oder zu pochen. Die Fasern sollen geschmeidiger und weicher gemacht werden, um sie für den folgenden Schwinggang, das spallar, vorzubereiten.
Bald verklopft die Bäuerin das feste rundliche Bündel einzeln auf einer Steinplatte oder auf dem harten Tennenboden mit einem kurzen schweren Holzbleuel, dem mogn. Bald reiht sie eine Anzahl der mis zusammen an ein Seil und verprügelt sie so gemeinsam auf der Tenne oder auf dem linnenbelegten harten Boden im Freien. Sie benützt als Schlaginstrument den Dreschflegel ( flugi ) oder den Dreschbengel ( pal ) je nach örtlicher Gepflogenheit. Weil die zuls alle an der Seilschnur haften, können sie beim „ Dreschen " nicht wegfliegen. Sie werden mehrmals gewendet 1 ). Wo aber die unter Wasserbetrieb stehende Bleuelpoche ( fallun ) zur Verfügung steht — so besonders in den flachsbauenden Ortschaften —, verrichtet diese das Bleuen der zulsfullar ). Siehe im folgenden das Bleuen und Pochen der ungebrochenen Flachsstengel.
Nach dem Bleuen erfolgt mit Zeit und Gelegenheit das Schwingen der wieder geöffneten zuls. Die Arbeiterin wirft die einzelnen Zopfsträhnen über die Kante eines aufrecht stehenden Holzbrettes und entfernt mittels Holzschwert die noch haftenden Splitter und Schaben2 ).
englisch brake usw., und wäre durch ihre Vermittlung den Romanen bekannt geworden. Der mit dem Instrument eingedrungene fremde Name wird aber durch einheimische Ausdrücke, die zermalmen, zerschlagen ( mit einer Keule usw. ) bedeuten und vielleicht zum Teil schon vorher der Hanf- und Flachsterminologie angehörten, ersetzt. "
12. Kapitel. Das Bleuen und Pochen der ungebrochenen Flachsstengel.
Sursilvanisch: Fullar glin.
Die älteste Geschichte der Flachskultur belehrt uns, daß das Brechen der Flachsstengel ursprünglich durch Handbleuen mit einer Keule oder einem Hammer stattfand. Die ägyptischen Wandgemälde von El Eab zeigen dies recht anschaulich. Die alten Räter haben zweifellos ausschließlich ihren Flachs gebleut. Heute ist das Verfahren in der Schweiz fast ganz erloschen. Unser Sursilvane hat sich das Flachsbleuen bei etwas verbesserter Technik bewahrt in seiner uralten Stampfe, dem fallun de glin.
Wir wandern an einem der immer sonnigen Oktobertage durch das stille weite Talbecken von Sedrun ( 1400 m ü. M. ). Kristallhell liegt die Landschaft mit ihren frisch verschneiten oberen Gebirgszinnen vor uns. An Holzzäunen und auf Holzbeigen, an den niederen Vordächern von Haus, Stall und Schuppen sonnen und trocknen zum letztenmal lange Reihen Flachsbündel, die einst der stemnada oder Rasenröste enthoben wurden. Sie verfallen heute dem Stampfwerk, um ihre zarten Bastfasern abzugeben. Bald im Weichbild einer Ortschaft, bald abseits erspähen wir ein braunes Häuschen am rauschenden Bach. Seine Wellen drehen gischtsprühend ein kleines Wasserrad an der Flanke der Hütte. Sie ist fensterlos. Nur an der offenen Türe lugt das Tagesgestirn hinein. Aus dem dämmerigen Innern ertönt vom frühen Morgen bis spät abends, Tag für Tag, durch mehrere Wochen das schrille Geklapper der fallenden und sich hebenden hölzernen Stampffüße. Zwei bis drei dieser klotzigen, runden oder kantig geschroteten Stampfkeulen ( pisuns ) bilden eine Batterie. Ihre hölzernen Fußsohlen sind flach, und ihre Widerlager am Fußboden bestehen aus dicken granitenen Platten. Zwischen beide werden die Flachsstengelbündel eingeschoben und zerdrückt. Die Bündel haben die Größe von drei bis vier brauncas, d.h. soviel als eine Hand ebensooft zu umspannen vermag. Die meisten Bäuerinnen bezeichnen sie als murglinada, im unteren Disentiser Talbecken hörten wir auch den Namen fullada ( Textfig. 4 ).
Die arbeitende Frau stößt kniend und rutschend je ein Bündel fortwährend unter die fallenden Holzklötze der Poche, dreht und wendet sie mehrmals, bis sie genügend gequetscht sind. Eine gewandte Person vermag drei Pochhämmer gleichzeitig zu beschicken. Bei trockenem Wetter geht die Arbeit leichter, weil eben die Stengel weniger feucht, aber um so spröder sind. An einem sonnigen Tage bewältigt die Bäuerin bei drei arbeitenden Pochhämmern etwa 15—16 mais ( der mais entspricht 25 braunca-Paaren gut; siehe auch unten: Das Schwingen des Flachses ). Eine Familie vermag an je einem Tage in der Regel ihren ganzen Flachsvorrat in der Poche zu brechen. So wechseln Mutter und Tochter jeder Familie des Gehöftes Tag für Tag, bis alle „ Vischins1'( Nachbaren ) ihren Flachs zum spadlar oder Schwingen vorbereitet haben.
Wenden wir uns zur Arbeiterin am fallun, an der Bleuelpoche! Mitleid ergreift uns und Bewunderung zugleich beim Anblick dieser andauernden Mühe, Vorsicht und Geistesgegenwart, bei dem ewigen Lärm, dem aufwirbelnden Staub und den herumschwirrenden Schaben. Vom Scheitel bis zur Fußsohle mit Staub und Splittern bedeckt, kniet das Mädchen bleichen Antlitzes vor den hämmernden Pochklötzen. Mund und Nase hat es oft leicht mit einem schützenden Tuche umhüllt. Aber gegen die streichende Zugluft ist es während des langen Tages nicht gefeit. Erkältung Flachs und Hanf und ihre Verarbeitung im Bündner Oberland.
und Schnupfen sind sein erster Lohn. Freilich gehört diesen braven Frauen und Mädchen wieder ein ganzes Jahr frische Bergluft und goldener Sonnenschein zu eigen. Ihr erstes Begehr bleibt doch das spätere feine weiße Linnenzeug.
Wir holen noch nach, daß das Heben und Senken der fallenden pisuns ( Pochhämmer ) eine baumstammdicke hölzerne Horizontalwelle ( igl — igl, arver ) mit ein- gelassenen hölzernen Schnapp-zähnen besorgt. Die Welle selbst wird vom Wasserrad und seiner einfachen Übertragung geführt und in langsame Drehung versetzt.
Die verholzten, faserfreien Stengelabfälle, die an der Bleuelmühle sich ergeben, sind eine sehr beliebte Viehstreue im Rindviehstall, da sie wie Sägespäne wirken; doch nicht für den Schweinestall wegen des vielen Staubes1 ).
Der Lichtbildner hat bei der Innenaufnahme einer Bleuelmühle seine liebe Not. Was bleibt ihm anders übrig, als auf das steinbeschwerte Schindeldach der niederen Walkhütte zu steigen. Als „ frecher Dachs " hebt er einige der dürren, großen Schindelbretter auf und verschafft sich im halbdunkeln, spreu- und staubschwangeren Räume das nötige Oberlicht. Die guten Leute ließen ihn gewähren ( bei Rueras, Tavetsch ).
Die Bewohner der Südlagen des Trunser und Ilanzer Talbeckens, die aus klimati- schen Gründen mehr Hanf als Flachs bauen, ohne auf letz- Fig. 4. Das Poohen des Flachses in Rueras ( Tavetsch ) ( fuller glin ).
teren ganz zu verzichten, denen außerdem heute die Bleuelpoche fehlt, z.B. in Schlans und Andest, schleizen und brechen ebenfalls die Flachsstengel. Es bleibt aber eine Ausnahmeerscheinung des Gebietes.
) Die Abfälle heißen las restas ( vgl. oben: farcaglia = Hanfstengelsplitter nach dem Schleizen und Brechen des Hanfes ). Die Bezeichnung rèsta = Schabezen, Flachsstengelsplitter, ( vom Verb restar = übrig bleiben, Überbleibsel ), möge aber der Leser wohl unterscheiden vom gleichgeschriebenen Worte rèsta, rista = Reiste, feines Flachswerg, feinste Flachsfaser. Die Bedeutung beider Wörter geht also diametral auseinander ( siehe unten: rèsta, stuppa, schuengia ).
f P. Dr. Karl Hager.
13. Kapitel. Das Schwingen des Flachses.
Sursilvanisch: spallar.
Der Landmann trägt die gequetschten Flachsbündel ( murglinadas ) in schwer beladenen Linnen zur Haus- und Hofstatt und birgt sie vorerst im trockenen, noch unbewohnten Kuhstall. Denn im September und Oktober weidet die milchspendende Kuh nach der Alpentladung auf dem idyllischen Maiensäß. Am Abend bläst der Junge von der tegia de misés aus seine melodisch einfachen, wehmutsvollen Weisen ins Tal hinunter. Ein riesig langes Blechrohr ist sein Blasinstrument. Wie oft lauschten wir diesen langgezogenen Tönen in tiefer Nachtstunde sinnend am Schreibtisch beim offenen Fenster.
Der Hausfrau wartet jetzt das brancar glin per spallar, d.h. die Sonderung der zermürbten heimgeschafften Flachsbündel in Büschelpaare. Je ein- Paar hand-großer Büschel werden durch Bastfasern verbunden. Beim Abzählen der Paare erhält die Hausfrau eine provisorische Schätzung ihrer zukünftigen mais ( 25 Paare Handfaserbüschel [brauncas] ergeben den mais ). So erkennt sie schon jetzt den Ertrag ihrer Mühen und Sorgen. Cents mais? wieviel mais? ist die gegenseitige, neugierige, oft etwas eifersüchtige Frage der befreundeten cummars e viscMnas, der Basen und Nachbarinnen. Sie obliegen dieser Arbeit immer an einem sonnig warmen Tage. Erst folgt noch eine Pflichterfüllung. Dem Besitzer der Bleuelmühle entrichten sie für die Benützung seiner Poche je zwei Paar brauncas gequetschten Flachses von jedem mais, den sie ausgerechnet haben.
Nun schreitet die Bäuerin getrost zur Arbeit am Schwingstuhl. Der schwere Pochhammer hat unseren Flachsstengel, zart wie das Wildgras der Alpen, wohl zum geknickten und gequetschten „ Rohr " umgestaltet. Erfassen wir aber ein Handbüschel, so stehen die Stengel beim Emporheben immer noch horizontal ab, obschon sie „ hundertfältig " gebrochen sind. Das Bündel soll aber, über den Schwingstuhl geschleudert, schlaff über dessen Kante hängen, mit anderen Worten: die Holzteile des Flachsstengels haften gebrochen noch großenteils am Bast. Erst ergreift die Arbeiterin, la spatlunza, sitzend ein Stengelbüschel und zerreibt dasselbe über ihren Knien tüchtig mit beiden Händen ( sfriar las brauncas ). So wird es schlaff, und manche Holzteile fallen bereits ab.
Alsdann beginnt der eigentliche Schwingprozeß, vorerst das Grobschwin-gen, das spatlar da pries, am Schwingstuhl ( Textfig. 5 ). Ein Holzbrett von etwa 90 cm Länge und 30-40 cm Breite steht hochgestellt und festverfügt auf einem flachen Holzfuß. Ein Ausschnitt von 26 bis 30 cm Breite und 12 cm Höhe am Kopfstück des Schwingbrettes ( la sphnda ) läßt oben einen Holzrest vorstehen, der eschrägt und dient als Schneide des ( Spada ) in Tavanasa.
Flachs und Hanf und ihre Verarbeitung im Bündner Oberland.
Schwingbrettes. Der Holzfuß ( pei ) steht nach links so weit vor, daß die Arbeiterin ihre :i i.
beiden Füße darauf setzen kann. So erhält das Gestell bei der Arbeit einen festen Halt. Wohl der Herrschaft dieser Frauenfüße ist es zuzuschreiben, daß der Sursilvane den ganzen Schwingstuhl als „ pei de glin " bezeichnet. Die sputlunsa selbst sitzt hinter ihm auf einem Lehnsessel, den sie der Wohnstube entnommen hat. Ihre rechte Hand führt das hölzerne Schwingmesser — la spada. Es hat etwa eine Länge von 60-70 cm bei 12 cm Breite, ist doppel-schneidig und aus Birken- oder Ahornholz geschnitten. Wir beobachten öfters ganz schmale Schwerter, weil sie schon von der Urgroßmutter geschwungen wurden und derart abgenützt sind.
Die Schwingerin umwickelt ihre linke Hand meist mit einem schützenden Tuche. Sie hält das gequetschte und zerriebene Flachsbündel, schleudert es über die Kante des Schwingbrettes, und sausend fährt das Fig. 6.
Holzschwert der Rechten über den hängen- in Curaglia ( Wedels ).
den Flachsteil ( Textfig. 6 ). Die Schabezen fliegen sprühend nach allen Seiten und blitzen im Sonnenlicht auf. Oft zieht die spattunza ihr Kopftuch weit nach vorn, um auch Augen und Gesicht zu schonen. Das Flachsbündel wird mehrmals gewendet, bis alle groben Stengelteile weggeflogen sind. Das ist der erste Gang am Schwingstuhl. Sehen wir uns seine Resultate an!
Vorerst liegen weit zerstreut die Stengelabfälle, die restas ( siehe oben: Das Bleuen des Flachses ). Dann hat sich um den Schwingstuhl ein Haufen Bast- und Faserreste aufgetürmt, die schuengia, der grobe Wergabfall. Der Tavetscher nennt ihn auch „ Mzu.
Dieses gröbste Abwerg steckt noch voll kleiner und größerer Stengelsplitter. Um sie zu entfernen, unterwirft die Bäuerin die wirre Masse abermals dem Schwing-stock, oder der ganze Haufen wandert neuerdings zur Poche und unter deren Hämmer, oder endlich wird er auf dem harten Pflaster des Hofes mit dem Dreschflegel weiter verklopft und gereinigt. Über die Verwendung der schuengia siehe unten: Zusammenfassung: rèsta, stùppa, schuengia.
Doch das Hauptprodukt ist die Langfaser. Sie wird zu faustdicken Strähnen ausgelegt. Zwei Frauen erfassen sie einzeln an den Enden, drehen sie mehrmals, falten sie einmal und formen eine jede zu einem Zopf, der bis zur Spitze verflochten und daselbst verknüpft wird. So entsteht der sogenannte „ geschwänzte " Zopf 1 ). 25 Paare derselben werden zu einem mais vereint, und zwar so, daß 24 Zopfpaare zu einem Bündel liegen, das letzte geöffnete Paar aber als Bundschnur dient. Das wäre nun der fertige, richtige mais.
Die Aufrüstung zeigt s' o recht, daß die Tavetscherin zwischen dem ersten und zweiten Schwinggang eine Spanne Zeit verstreichen läßt. Ihrer wartet eben allseitig Arbeit. Da will sie erst Ordnung schaffen und überall „ sauberen Tisch " haben.
Nach unseren langjährigen Beobachtungen leistet die Bündner Oberländerin zwei Drittel sämtlicher Handarbeiten auf Acker, Feld und Wiese und im Haus und Hof. Auf dem Frühjahrsackerfeld hat sie die Hauptlast lind zugleich die ungesundeste Arbeit. Bei der ganzen sommerlichen Heuernte und wieder bei dem Einheimsen der herbstlichen Feldfrucht steht sie gleichwertig dem Manne zur Seite. Sie führt ebenso die Sense wie die Sichel. Spätherbst und Winter belasten sie abermals stärker. Ihrer harrt sozusagen nie die beschauliche Ruhe. Eine erlösende Abwechslung schafft ihr nur der stille Sonntag und sein Kirchgang. Die wetterharten Züge im Antlitz der kräftigen Bäuerin und die Runzeln des alten Mütterchens verkünden den Adel und die Schönheit aus der schweren, langjährigen, nie erschlaffenden Arbeit. Das Ideal des „ Herrn der Schöpfung " aber ist heute die Viehzucht. Sein Glück ist voll, wenn im Herbst die Viehhabe gutgenährt und wohlgeformt von der Alp zurückkehrt. Nicht selten bemerkten wir eine allzu dunkle Färbung des Milchkaffees beim Frühstück und Vesperbrot am Familientisch, wo auch viele junge „ Mäulchen " sich öffneten. Allein die „ lieben " Kälber im Stall nahmen den besseren und größeren Anteil der milchspendenden Kuh hinweg. Doch kehren wir zurück zu unserer verwickelten Technik der Leinfaserbereitung!
Auf den ersten Schwinggang folgt der zweite, das spatlar da fin, das Fein-faserschwingen. Die Einleitung macht die Bäuerin damit, daß sie alle mms-Bündel auf die Bank am erwärmten Ofen stellt. Die Fasern sollen noch einmal gut ausgetrocknet werden. Der Vorgang des folgenden Schwingens ist der gleiche wie beim ersten. Der erneute Faserabfall ergibt die stuppa de schuor, ein bereits besseres Abwerg, das direkt dem Hechelgang anheimfällt, wie die gewonnene Feinfaser, die Reiste. Wiederum flicht die spatlunza neue poppas oder Flachszöpfe. Doch sind diese nur am Rückenwulst gedreht, ihre Enden aber hängen frei herab. Die Hausmutter legt sie sorgfältig der Länge nach in die canastras = länglich ovale Körbe. Hier harren sie bis das Hecheln erfolgt.
Auf unsere Fragen, ob auch beim zweiten Schwingen und selbst später noch beim doppelten Heehelgang feine und feinste restas oder Stengelreste der Flachsfaser anhaften, erhielten wir zur Antwort: restas dat ei naven da fullar entochen tier la camischa = solche Überbleibsel gibt es von der Bleuelmühle bis zum fertigen Hemd.
Der Oberländer Romane überträgt diesen Befund auf den Spottvers: Glin senea restas, femnas senza capresi, umens senza fei eis ei buca d' anflar = Lein ohne Schabezen, Weiber ohne Grillen, Männer ohne Galle oder Zorn sind nicht zu finden.
Wir müssen noch einmal zum Schwingstuhl zurückgreifen. Das Tavetscher, Medelser und Disentiser Talbecken besitzen ausschließlich die oben beschriebenen niederen peis de glin, welche der Schwingerin das Sitzen bei der Arbeit erlauben. Im Trunser und Ilanzer Talbecken finden wir sie ebenfalls. Allein der Schwingstuhl erreicht dort oft die Höhe von 120 cm und noch mehr, an dem die spatlunza stehend schwingt ( z.B. in Ruis ). Die längeren Strähnen des Hanfes mögen die dortigen Bäuerinnen zu diesem Modell verlockt haben. Übrigens bindet sich die Flachs und Hanf und ihre Verarbeitung ist Bündner Oberland.
Oberländerin an Orts- und Gewohnheitsgebräuche, an die Schablone, ebenso ungern als ihr Eheherr an beengende Forst-, Jagd- und andere Polizeigesetze. Der indi-'viduelle Autonomiesinn ist überall hoch entwickelt.
Bei unseren herbstlichen Wanderungen sahen wir meist die Hausfrau allein oder mit ihrer Tochter dem Schwingen obliegen. Sie sitzen am Eingang des verlassenen Kuhstalles unter der vorspringenden Heulaube, oder sie haben sich im Stalle selbst ein windstilles Plätzchen ausgesucht. Grobe, aber saubere Linnentücher sind zur Aufnahme der feinen Flachssträhnen und der Hede auf dem Boden ausgebreitet. Oft wieder treten in größeren Ortschaften die Mädchen zusammen, um einander helfend beizustehen. Es arbeitet sich so viel lustiger. Bald suchen sie in sonniger Oktoberlandschaft zwischen den Stadeln und Kornhisten Aufstellung, indes rundum die Dreschbengel der Mannsbilder auf den Tennen den Ticktack schlagen. Bei trüber Witterung sucht die jugendfröhliche Gesellschaft ebenfalls im dämmerigen Kuhstall Unterschlupf. Die Arbeiten hüben und drüben, auf der Tenne und am Schwingstuhl, verlangen Pausen zum Verschnaufen, Reden und gegenseitigem Necken. Wird die männliche Zudringlichkeit den Flachsjungfern zu arg, so ergreifen sie die köstliche Waffe der Schabezenhaufen zu ihren Füßen und schlagen siegreich mit Hülfe der spitzen, kitzligen Stengel Splitterbomben die Dreschbengel jungen in die Flucht. Allein die „ böse " Mittagspause gibt zu erneuten Bitten, Drohen, diplomatischen Erörterungen und abermals Necken Anlaß, wenn die „ Kuhstallbewohne-rinnen " sich etwa eingesperrt finden oder bei erneutem Schaffen und Ringen alle ihre Schlagschwerter und selbst den einen und anderen Schwingstuhl auf die oberste Planke einer mächtig hohen Kornhiste entrückt erblicken. In solch luftige Höhen wagt sich auch die keckste Schwingerin nicht empor. Jugendlust und Liebe rufen nach dem unschuldigen harmlosen Zank und Scherz.
Vor fünf bis sechs Dezennien hatte das Flachsschwingen zweifellos einen fest-licheren und kommunaleren Charakter. Eine behäbige Bauernfamilie lud alle mattauns, die Mädchen, auf einen bestimmten Tag zum Schwingfest ein. Als Lohn gab es marenda ( Vesperbrot ), tscheina ( Abendessen ) nach der Tagesmühe und abermals den puschegn ( Nachtmahl ) nach Mitternacht. Da schwang man nicht nur den Flachs. Alle Neuigkeiten, Verlobungen, Hochzeiten wurden „ geratscht " und „ gehächelt ", ohne Holz und ohne Eisen, einzig durch das Gehege der Mädchenzähne. Der Hauptanziehungspunkt für die spatlunzas blieb aber doch der Tanz nach dem nächtlichen puschegn.
Der verstorbene sursilvanische Dichter Giachen Caspar Muoth hat in einer Idyllesolch ein Spallunmie&t geschildert und den Volkston gut getroffen. Er läßt eine seiner spatlunzas, die Rosina, folgendes Schwinglied singen:
Bai, spaüunzaSchwinge, Mädchen,2 ) Tgei speronsaBis am Rädchen Schai cheuHoffnungsvoll, En quei glinZart und fein Manedd finGlänzt der Lein!
Bella rèsta Nossa vesta Sa far Terlischar TP admirar.
Was wir schwangen Gibt den Wangen Einen Glanz Stolz und klar Wunderbar.
f P. Dr. Karl Hager.
Biara rèsta Nus dadesta Lu si In murons Flachs in Hülle Weckt in Fülle Junges Blut, Burschen sind Seh'ina dunna Ver sin cruna Sa bia Glin spatlau, S'ei gartiau.
Quellas poppas Pops e poppas Lain bein Enfischar E schigentar.
Spalla pia Gun legria!
Glin fin Bein spatlau Ei miez filati.
Ja, hat Eine Reich im Schreine Schönen Flachs: Jedes Stück Ist ein Glück.
Das gibt Windlein Für die Kindlein; Trocken fein Im Gebind Ruht* das Kind.
Mädchen, singet, Da ihr schwinget Fein den Flachs! Zart und rein Spinnt sich fein.
Eis megliers ons. Dann wohlgesinnt.
Quella malta Ei ca fatta Tgi sa? Bin ci uss E prendati nus.
Bellas teilas Ein las steüas Gie franc, Be grand defy En ina letg.
Wie die Mädchen, So die Fädchen, Sagen sie; Froh bereit Wird gefreit.
Die da spinnen Schönes Linnen, Werden wohl Einst als Frau'n Sterne schau'n.
Heute ist das Flachsschwingen auf den hellen Tag beschränkt. Der trauliche Mond kreuzt jetzt vereinsamt über die nachtstillen Gehöfte des bergumkränzten Tavetschertales. Er leuchtet nicht mehr den fröhlichen Gruppen der im Mondschein hantierenden Schwingerinnen und Spinnerinnen. Die Feuerpolizei verbietet längst diese Nachtarbeit bei Licht im Stall. Die Volksüberlieferung sagt den spaüunzas von Selva nach, sie hätten einst aus Unvorsichtigkeit ihr Dörfchen in Brand gesteckt und in Asche gelegt* ). Doch hat sich bis in die Gegenwart noch manche schöne, nächtliche Volkssitte erhalten.
14. Kapitel. Das Hecheln der Flachs- und Hanffasern.
Sursilvanisch: tscharschar.
Schleizen und Brechen, Bleuen und Pochen, das zweimalige Schwingen haben die Fasern des Hanfes und Flachses zum Hechelgang vorbereitet. Das Hecheln soll die noch zu breiten, zum Teil zähe verbundenen Fasern der Länge nach spalten und scheiden, doch nicht zerreißen und verkürzen. Also abermals Scheidung! Auch sie bringt Abfall oder Abwerg, doch bester Qualität ( siehe unten Zusammenfassung: rèsta, stappa, schuengia ).
Was ist die Hechel? Unsere romanischen Kinder geben die Definition in einem ländlich lieblichen Rätsel:
Ina tgaura alva va iras in uaul de fierRisposta: H glin va iras tscharieschEine weiße Ziege geht durch einen Wald von EisenAntwort: Der Lein ( die schimmernd weiße Strähne ) wandert durch die Hechel2 ). "
. ' ) Brand von Selva 1785, den 15. Oktober. Vgl. P. Baseli Berther. Selva avon 100 onns, 1909.
Flachs und Hanf und ihre Verarbeitung im Bündner Oberland.
Wir treffen meist einfache Handhecheln ( Textfig. 7 ). Die Brettlänge schwankt zwischen 40-70 cm, die Brettbreite zwischen 10 und 16 cm. Die beiden Brett-enden haben ausgeschnittene Öffnungen bzw. Handhaben. Durch die eine Öffnung zieht die Arbeiterin beim Gebrauch eine kurze Seilschlinge, setzt sich alsdann auf einen niederen Schemmel und streckt die Beine. In die Schlinge schiebt sie den einen Fuß und verstemmt so das Hechelbrett am Boden, das sie schief geneigt zwischen beide Knie faßt. Oder sie schiebt erst in die Schlinge ein Querholz und stemmt dann beide Füße auf dieses, so erhält sie noch festeren Stand ( Textfig. 8 ). Fig. 7. Grob- und Feinhecheln für Hanf und Flachs ( tschariesch ) Die linke Hand hält direkt ( Tavetsch).den Grjff der oberen Rand habe, indes die Rechte den Leinstrang über die Hechelzähne schlägt und streicht. Der Hechelkamm selbst steht bei der Handhechel in der Mitte des Langbrettes und ist immer vielreihig. Die eisernen Zähne sind in verjüngende Kreise, seltener quadratisch, geordnet. Die einreihige Vorhechel haben wir nirgends beobachtet. Die sorgfältigen Vorarbeiten des Schleizens, Brechens, Bleu ens, Pochens und Schwingens machen sie entbehrlich. Dagegen treffen wir meist die Grob- und Feinhecliel ( Aus-machehechel ). Die Zahnreihen der Grobhechel sind nach oben recht oft sparrig ausstehend ( trichterartig ) und haben scharfkantige große Zähne. Jene der Fein-hechel sind zarter und glatt, stehen locker und vertikal. Größe und Zahl der Zähne, ihre Feinheit und ihr Abstand, ihr Querdurchschnitt, bald rund, bald scharf quadratisch, ist ungemein wechselnd von Familie zu Familie. Fig. 8. Das Hecheln ( tscharschar ) des Flachses ( Sedrun ). Oft tragen die Bretter die Hauszeichen und verraten ein ehrwürdiges Alter bzw. eine starke Abnützung. Alles wird verständlich! Wie oft betraten wir eine winterliche Stube und fragten nach dem Alter und Ursprung des Webstuhles, des Spinnrades, des Haspels, der Hechel usw.
Die guten Töchter antworteten uns: il tat ha fatg quä = der Großvater hat 's gemacht. Ja, in der warmen Stube der kurzfristigen winterlichen Tage schnitzelt und schafft der Bauer vielfach sich seine sommerlichen Heuinstrumente, aber auch das winterliche Werkzeug für sein Frauenvolk. Da gibt 's echte Originalarbeit, keine Schablone! Eine Ausnahme macht das schwierige Spinnrad. Fast jede größere Ortschaft hat heute noch ihren Spinnradmacher.
Ein uraltes sursilvanisches Rätsel könnte man dahin deuten, daß der ursprüngliche Hechelkamm im Oberland Hartholzzähne bzw.stifte besessen hätte. Wir vermochten aber kein solches Instrument mehr zu erfragen. Das poesievoll gegliederte Rätsel lautet: Siarps alvas, ehe van Iras in uaul de lenn dir e laian vid ils pegus la palegna? Las maseinas de glin van iras il tschariesch = Weiße Schlangen kriechen durch einen Wald von hartem Holz und lassen ihr kurzes Haar an den Bäumen? Die Flachssträhnen des Leins gehen durch die Hechel.
Einzelne Bäuerinnen gebrauchen nur eine Hechel, obschon auch sie die Lein-stränge zeitlich zweimal durch die Kämme ziehen. Auf unsere diesbezügliche Anfrage ändert die Hausfrau nur die Handhabung bei der zweimaligen Arbeit; doch dieses schwierige Kunststück spottet jeder Beschreibung.
In jeder Talschaft, aber nicht häufig, treffen wir die Doppelhechel auf dem gleichen Brett. Die Laden sind entsprechend länger, bis zu einem Meter. Das eine Ende trägt den groben, das andere den feinen Hechelkamm. Die Instrumente werden auf eine Bank oder einen Tisch gebunden; die Frauen sitzen oder stehen bei der Arbeit.
Der Vorgang des doppelten Hecheins zeigt uns wieder so recht die Sorgfalt der Bäuerinnen. Wir wählen als Musterbeispiel das Flachshecheln im Tavetschertale. Dem ersten Gang durch die Grobhechel ( tscharschar da gries ) unterliegt der Reihe nach der ganze Vorrat des Flachses, sobald die Hausfrau die nötige Zeit dazu gefunden hat. Durch den Hechelkamm wandert jedesmal eine ganze poppa de glin. Die Arbeiterin legt je fünf gehechelte Stücke nebeneinander und dreht sie zu einem neuen großen Zopf zusammen, dem sogenannten pùp. Diese harren der Zeit, bis das Spinnen an den Winterabenden beginnt. Meist legt die Hausfrau àie pùps in eine Stande im Keller. Bedarf sie des Vorrates im laufenden Jahre noch nicht, so läßt sie ihn ein ganzes Jahr über im Keller stehen. Je älter die Zöpfe im feuchten Keller werden, sagt sie, desto geschmeidiger und weicher gestalte sich die Faser zum Spinnen.
Den zweiten Hechelgang, das Feinhecheln ( tscharschar da fin ), unternimmt die Hausfrau erst unmittelbar vor dem Spinnen, und zwar immer nur ruckweise, sobald sie je 3 — 5 pùps gemeinsam an. den Spinnrocken befördern will.
15. Kapitel. Am Spinnrad. Leinfaser und Wolle.
Der Sursilvane hat den Spruch: sez filau e sen tessiu, dal in meglier vestgiu = selbst gesponnen und selbst gewoben ergibt den besten Loden. Das gilt heute noch in erster Linie von seinem Wollkleid. Das Eigenspinnen der Leinfaser aber hat im Bilndner Oberland an den meisten Orten viel eingebüßt. Das ist keineswegs auf den Rückgang der Gespinnstkulturen allein zurückzuführen.
Ein Bauer sagte uns auf eine diesbezügliche Frage: Wir haben oft zu wenig „ Weibervolk " im Haus, denn manches Töchterlein, sobald es der Schule entwachsen.
Flachs und Hanf und ihre Verarbeitung im Bündner Oberland.
ist, sucht bereits sein Brot auswärts zu verdienen oder einen Frauenberuf zu erlernen und beraubt so das väterliche Heim der Frauenhände. Andere Zeiten erfordern andere Ansprüche. Die junge romanische Bündnerin beseelt oft der vollberechtigte Wunsch, in der deutschen Schweiz sich die wichtige Fremdsprache anzueignen und in einem guten Haushalt lernend Umschau zu halten. Die schneeigen Bündner Berge führen die gereifte Jungfrau schon wieder der Heimat und ihrer Ackerscholle zu. Nicht selten bannt ein selbstgewählter Bund fürs Leben sie für immer an die Fremde, zumal wenn ihr wenig Aussicht winkt, in der Heimat sich zu verheiraten. Wir beobachten dies periodisch in vielen kleinen Oberländer Dörfchen. Noch schlimmer ist, wenn manche Tochter sich der Hotelindustrie zur Verfügung stellt, dann erlernt sie das Schleizen und Spinnen nicht mehr.
Die Hausmutter aber vermag nicht alles und jedes zu bewältigen. Ja, Weben will sie noch gerne, wenn es immer geht. Also schickt die Bäuerin ihre poppas de glin ne conniv, ihre Lein- oder Hanffaserbündel, vielfach in die mechanische Spinnerei und läßt sich den fertigen Faden nach Hause schicken. Die Maschine erzeugt heute einen feinen Faden, den die Frauenhand zu erstellen meist nicht mehr imstande ist. Gerade deshalb senden fast alle Hausfrauen wenigstens die Grobfaser des Abwerges, sowohl der schuengia wie der stuppa, zur Erzeugung des Fadens in die Fabrik. Außerdem kommt das Spinnen von Hand die Hausfrau teurer zu stehen, wenn sie aus Zeitmangel die Arbeit einer Privatperson überlassen müßte.
Endlich erhält im Winter die Leinfaser eine große Nebenbuhlerin. Sie steht nicht mehr allein. In den Körben und Linnen liegt haufenweise die schimmernde, rein gewaschene und gekrempelte Wolle des bündnerischen Hausschafes. Auch sie will zum Spinnrad! Dazu sagt uns heute jedes Töchterlein: Die Wolle ist leichter zu spinnen. Also auch Bequemlichkeit! Betreten wir die frühwinterliche, warme bis überhitzte, aber geräumige, lichtvolle Wohnstube, so steht doch meist ein Spinnrad in einer Fensternische zwischen Geranien und Nelken.
Allein nicht so häufig grüßt uns der hohe Dreifuß mit dem pendelnden gleißenden Rocken, vom farbigen Band umschlungen. Statt seiner schmiegt sich ein Körbchen mit weißer, schwarzer, brauner oder scheckiger, mollig'er Wolle siegreich ans Spinnrad.
Ende September kehren allerwärts die großen blockenden Scharen von der Alp zur heimatlichen Hürde. Gar viele sehen ihr neues Heim zum erstenmal, denn hoch droben, unmittelbar an der Schneegrenze, haben sie ihre Äuglein erst für die mächtige Gebirgs- und Firnwelt geöffnet. Der spekulative Schäfer, der nurse, denkt prosaischer. Für jedes auf der Alp geborene Stück erhält er einen Extralohn von 80 bis 150 Centimes, je nach Übung der einzelnen Ortschaften. Aber er darf ja nicht vergessen, sie mit dem Hauszeichen des Mutterschafes zu versehen. Schließlich gibt es doch noch solche herren- und mutterlose Lämmchen. Der Hirte wird bei seinem „ Tausend " und noch mehr nicht alle gewahr. Erst prüft man, ob nicht eines der verlassenen Kleinen eine besondere Zuneigung zu einer alten Schafmutter zeige; wenn ja, so wird es dieser zugeteilt. Sonst werden die ungezeichneten Lämmer dem Alppächter oder Alpbesitzer zugesprochen. Im Tavetschertale verfallen sie der Talkirche des heiligen Vigilius und kommen zur Versteigerung. Das ist die Freude der Buben und Mädchen! Längst schon haben sie auf die Vergeßlichkeit des Hirten spekuliert. Der gute bah oder Vater muß ihnen eines dieser mutterlosen „ Kirchen-lämmer " „ erganten ". Es wandert zu den Milchziegen und Kühen des väterlichen Stalles, und mit der Kindermilchflasche oder dem „ Nuggi " ziehen die jungen Tavetscher ihren neuen kleinen Freund heran.
Bei der Alpentladung trägt das Pferd alle Lämmer in Körben wohl verpackt zu Tal. Die ganze Herde, Groß und Klein, wandert erst in den „ clans de zavrar nuormsu, in den Pferch, wo die Schaf Verlesung stattfindet. Bei dieser zarrada ist das ganze Dorf „ auf den Beinen " und voller Erwartung. Sie dauert oft einen ganzen Tag. Es ist ja bei der Masse nicht so leicht, die Tiere an ihrer la noda oder dem snez, dem Ohrzeichen, für einen jeden Besitzer zu erkennen. Buben und Mädchen entwickeln beim Verlesen eine besondere Routine. Überall folgt gleich die Schafschur. Die Tiere gehen zum kommunalen Weidgang über. Die gewaschene Wolle wurde früher mit der Handkrempel aufgekämmt; heute besitzt jedes größere Dorf seine Kardätschenmaschinerie ( sursilv. scarsiniera; scarsinar = krempeln ).
In bezug auf die Kleidung folgt der Mensch seinem Naturtrieb und läßt sich von der Scholle, die er inne hat, diktieren. Die Bewohner der Alpen, der gebirgigen Mittelmeerländer und der Steppen besitzen mehrheitlich das Wollkleid, das ihnen die Haus- und Wildtiere liefern. Wir erinnern nur an das wollspendende Schaf der Alpenländer, der spanisch-kastilischen Hochebenen, an die Heidschnucke der Lilneburger Heide, an die westasiatische Bezoar- und Kaschmirziege. Die zentral-und südwestasiatischen Steppen- und Wüstengebiete, jene Nordafrikas und die Hochgebirge der amerikanischen Anden besitzen die Vertreter der feinwolligen Kamele. Unser Bündner Obwaldner, mit „ Kind und Kegel ", liebt ebenfalls seinen Schafwoll-loden als Obergewand. Abertausende seines kleinen Bündnerschafes beweiden im Hochsommer die jähen Staffeln seiner Alpen hoch über der Baumgrenze, wohin der Fuß des schwerfälligen Rindviehes sich nicht mehr setzen kann.
Dagegen waren die Slaven, Germanen und Kelten in ihren mattengrünen Niederungen von jeher Liebhaber linnener Kleider. Vom sibirischen Ural quer durch Mitteleuropa bis zur Atlantis des britischen Inselreiches, vorab Irlands, sind Hanf- und Flachsbau heute noch allmächtig. In der Glanzzeit der Hausindustrie der Leinfaser des Früh- und Spätmittelalters war nur das viel besungene Handspinnen mittels Rocken und Spille ( freie Spindel, sursilv. il fis ) in Übung. Wir erinnern an die sagenumkränzte, in Lied und Poesie viel bewunderte königliche Spinnerin Bertha ( Bertrada ), 783, Tochter des Grafen Charibert von Laon, Gemahlin Pipin des Kleinen und Mutter Karl des Großen, und die geflügelten Worte: „ Die Zeit ist hin, wo Bertha spann. " Nach der Legende erkennt Pipin seine von neidischen Großen in die Wildnis verstoßene echte Braut Bertha an ihrem großen Fuß, den sie vom Spinnen hat1 ). Pipin aber und Karl marschierten auf ihren italisch-longo-bardischen Heereszügen via Lukmanier durch unser Bündner Oberland. Vom Rocken zogen und ordneten die königlichen und adeligen Frauen des Mittelalters die Faser und drehten sie zum Faden. Dieses Handspinnen mittels der freien pendelnden und am Boden rollenden Spille hat sich im Bündner Oberland vollständig verloren, gleichwie in der deutschen Schweiz, sich aber im ennetbirgischen Tessin in seiner anmutsvollen Poesie zum Teil noch erhalten. Wir hatten Mühe, die einen und anderen Relikte alter Spillen aufzuspüren. Bei manchem ehrwürdigen Madonnenbild der Kirchen des Gebietes sahen wir früher noch diese Symbole der adelnden königlichen Flachs und Hanf und ihre Verarbeitung im Bündner Oberland.
Frauenarbeit. Sie ergab an der freihängenden Handspille die feinsten Garne und unübertroffene Gewebe.
Aber schon früh wurde das Handrad beim Spinnen erfunden. Erst mußten sich zwei Personen beteiligen, die eine zog den Faden vom Rocken auf die Spille, die andere drehte das Rad. Ein Ableger dea Handrades ist der sogenannte „ Spinnbock " in für Wolle. Er besteht wesentlich aus einem größeren Handrad auf einem einfachen Holzgestell. Das Rad selbst hat verschiedene Konstruktionen, ist aber leicht gebaut. Eine Schnur mit „ ewigem Umlauf " führt von der Nute der Radfelgen nach links abwärts zum Fußrahmen des Gestelles auf eine kleine Holzscheibe an der Spille. Diese hat noch ganz die Form der Handspille, nur besitzt sie eben eine winzige Radscheibe mit Nutenführung zur Aufnahme der Spinnradschnur. Auch die Gewinnung des Fadens erinnert uns wieder an jene mit Hülfe der freien Handspille. Drei Finger der erhobenen Linken halten ein Biischelchen Wolle, indes die benachbarten Daumen- und Zeigefinger den Faden entlocken und zur Spille leiten. Die rechte Hand aber bringt das Schwungrad in einmalige Umdrehung und windet so den entstehenden Faden um die rotierende Spille. Uns erschien das Entlocken des Wollfadens als ein wahres technisches Kunststück. Der Faden soll auch viel feiner werden als bei Benützung des Trittrades Im Bündner Oberland sahen wir nur ein einziges derartiges Handrad in Disentis; es wurde einst von Rodels her eingeführt. Der „ Spinnbock " dürfte aber in alter Zeit dem Oberland neben der Handspille ebenfalls zu eigen gewesen sein; auch das benachbarte zentrale Bündten besitzt ihn1 ).
Heute spinnt unsere Oberländerin überall mit dem Trittrad. Dasselbe ist jung. Erst im Jahre 1530 hat es der Bildschnitzer Joh. Jürgens in Braunschweig erfunden. Damit trat das deutsche Spinnrad seinen Siegeslauf durch Europa an. Das treibende „ große " Rad, die sogenannte „ Tritt ", ist viel kleiner als beim Handrad, etwa 30-50 cm hoch. Über demselben wurde die Spindel mit den bekannten hölzernen Flügeln und der Spule angebracht. Dieses Rad fand Eingang bis in die tiefsten bündnerischen Alpentäler. Heute treffen wir dasselbe besonders im Albulagebiet und im Engadin. Allein im Bündner Oberland ist es in seiner typischen Konstruktion geradezu eine Seltenheit. Das sursilvanische Rad besitzt zwar die Tritt-einrichtung und die Flügelkonstruktion an der Spindel, hat aber seinen ursprünglichen großen Durchmesser beibehalten ( Tafelfig. 9 ). Der gesamte Flügelapparat der Spille und Spule mußte daher seitwärts linker Hand angebracht werden. Die starke Schwungkraft dieses Rades erleichtert die Trettarbeit der Spinnerei, erschwert aber die Gewinnung eines ganz feinen Fadens. Unser Obwaldner nennt das kleine deutsche Spinnrad das „ Schwobenraddas seinige bezeichnet er selbstbewußt als „ Bündner-rad ". Wir beobachten es ebenso im nordöstlichen Graubünden i ). Das Biindnerrad verwendet die Oberländerin sowohl zum Spinnen der Wolle wie der Lein- und Hanffaser.
Beim Wollspinnen ( Tafelfig. 10 ) legt die Arbeiterin über die Knie ein leichtes weißes Linnen oder auch ein altes Zeitungspapier, um den zu führenden Faden besser zu sehen und zu überwachen. Ein Körbchen mit Wolle liegt ihr zur Seite; eine Handvoll nimmt sie jeweils als Vorrat auf die Knie. Das Wollspinnen am Trittrad stellt die geringsten Anforderungen an das Können. Die Oberländerin macht daher ihre junge Tochter erst mit diesem vertraut.
. ' ) Siehe „ Hemd und Ho s a " von G. F i e n t, im Schweiz. Archiv für Volkskunde, 6. Jahrg. 1902. Volkskundliches aus dem Schanfigg.
16. Kapitel. Haspeln und Spulen, Zetteln und Weben.
Wir wissen bereits, daß die Oberländer Bäuerin noch häufig webt. Den Faden von der Spinnradspule hat sie längst gleich nach dem Spinnen auf dem Haspel zum Garnstrang geformt1 ). Auffallend ist, daß sie an dem kleinen Instrument keinen „ Zähler " hat, der die Zahl der Umläufe durch ein Zeichen angibt. Als wir den Frauen von dieser praktischen Einrichtung am Haspel des übrigen Bündten erzählten, gerieten sie in nicht geringes Erstaunen. Ihr Instrument hat in der Mitte des unteren Querholzes des Gestells, auf dem die Haspelflügel laufen, nur eine Öse, die den Faden genau auf die Mitte des Fliigelrahmens dirigiert2 ). Die Hasplerin zählt also selbst die Umläufe oder verläßt sich auf das richtige Maß ihres Empfindens und ihrer Schätzungsgabe. Mit gekräuselten Lippen meinten einige Tavetscherinnen: sie träfen das Richtige regelrecht sonst; übrigens hätten sie für den späteren Zettel Ersatzspulen. Da die Leute nur für den Eigenbedarf haspeln, so wird das exakte Maß der Strangumläufe ihnen auch nicht zur Pflicht gemacht.
Im Tavetschertale hat jeder Garnstrang bei der Wolle 500 Umläufe; 20 Stränge ergeben 20 Ellen. Beim Flachs erhebt die Hasplerin heute 800 Umläufe. Früher machten sie deren 1000. Der Leinfaden, berichten uns die einfachen Frauen, sei jetzt rauher und gröber wie früher. Unser Interesse erweckte besonders die Bemerkung, die Ursache des gröberen Fadens liege darin, daß der selbst gezogene Flachs heute nicht mehr die feine Faser von ehedem liefere. Schuld sei der jährliche Frost, der den Pflanzen schade. Liegt in dieser Auffassung ein wahrer Kern, so möchten wir den Grund viel eher auf die Entartung der „ ewig " selbstgezogenen Gespinstpflanze zurückführen. Es dürfte in diesem Falle der Versuch einer Auffrischung des Samengutes von Vorteil sein. Mit unserer Entgegnung, es möchte die weniger exakte Arbeit beim Spinnen der Grund des gröberen Fadens sein, weil ja das Spinnen langsam aus der Übung komme, waren die guten Frauen natürlich nicht einverstanden. Allein im stillen Herzenskämmerlein gedachten wir der einstigen feinen Gewebe mit ihrer schönen Musterung, die unsere Oberländerinnen in alter Zeit geschaffen und jenes Ausspruches einer Bäuerin: man könne auch von Hand den feinsten Faden spinnen, wenn man nur wolle und es verstehe.
Alsdann erfolgt das Waschen und Laugen der Stränge. Die Arbeiterinnen verknüpfen je fünf Stränge zu einem Garnbündel und weichen sie einige Stunden erst im lauwarmen Wasser auf. In der Zwischenzeit fertigen sie konzentrierte Holzaschen-lauge. Die abgeklärte Flüssigkeit wandert in einen großen Holzzuber, der Aschenrest auf den Düngstock. Je drei bis vier der aufgeweichten Strangbündel schieben die Frauen an eine Holzstange und hängen deren ebenso viele in die Laugenbrühe. Das Holzgefäß nimmt also mindestens 60 Stränge oder maseinas auf. Allmählich beginnen Flachs und Hanf und ihre Verarbeitung im Bündner Oberland.
die Strangfäden sich zu bräunen und zu fasern ( spelatschar ). Sie werden der Lauge entnommen, gewaschen und getrocknet.
Geschäftige Hände stülpen die Stränge einzeln auf die niedlichen schlanken Stäbe des Garnbrettständers, und das Spulrad wickelt sie von dort auf die Zettel-spule 1 ). Diese ist größer als jene am Spinnradflügel, 20 Zentimeter lang. Unsere Oberländerin spult ihrer zwanzig Stück für den zukünftigen Zettel, nebst einigen Ersatzspulen ( Textfig. 13 ). Hat die Hausfrau ihren Vorrat an Leinzöpfen der mechanischen Spinnerei übergeben, so kommen die fertigen Zettelspulen an sie zurück. Sie liegen wohl verwahrt in Körben, bis das Eigenweben beginnt.
Den Anfang macht die Aufrüstung des Zetteins ( sursilv. urdir ). Das Zetteln hat eine gewisse Feierlichkeit, und die Arbeit mit ihren voluminösen Instrumenten nimmt fast die ganze Bauernstube in Anspruch. Der Sursilvane faßt den Vorgang in den Satz: In truchet cun vegn cauls, en ils quais vegn mess cantals fil et urdiuIn ein ,Spind' mit 20 Fächern schickt man den Faden in 20 Knäueln und zettelt.Das „ Spind " ist ein hochgestellter Holzrahmen, den eine mittlere Längsleiste in zwei gleiche seitliche Hälften teilt. Zehn eiserne Stäbchen führen quer in gleichen Abständen durch das Fachwerk und schaffen so ein Gitter von 2X10 LängsreihenGarnbrettständer = sursilv.: plitguira; im Tavetsch vernahmen wir auch den Namen: spannagiada. Spulrad = roda de speuls; spulen = far si speuls; Zettelspulen = ils speuls d' urdù: — es ist der sogenannte Spuhlrahmen ( sursilv. la geina = Holzgitter ). Jedes Fach nimmt eine Spule auf. Die Fäden führen von den 20 Spulen erst durch ein schmales Brett mit 2X10 Öffnungen, das Zettelscheit, die spada d' urdir, und gelangen von da weiter auf den eigentlichen Zettelrahmen oder Zettelhaspel, den scav d' urdir.
Ein Mädchen überwacht mit Hülfe des Zettelscheites den geregelten Verlauf der vom Spulrahmen sich abwickelnden Fäden. Es leitet selbe langsam in die linke Hand jener Arbeiterin, welche den Zettelrahmen dreht. Dieser ist ein um die eigene Achse drehbares Holzgestell mit vier sich kreuzenden Flügelrahmen. Seine Längsleisten haben Kerben, um den Garnstrang beim Aufhaspeln im richtigen Abstand zu halten und eine Verwirrung des Stranges zu verhindern. Dem Leser gibt übrigens das Bild ( Fig. 13 ) den besten Aufschluß. Aber nur anzudeuten vermögen wir das Kreuzen der Fadenstränge oben und unten am Zettelrahmen an zwei hölzernen vorstehenden „ Fingern " ( las tscharnas ). So oft die Zettlerin oben oder unten beim Drehen des Haspels anlangt, kreuzt sie erst die Fäden zwischen ihren eigenen Fingern und schiebt die entstandenen Schlaufen an die hölzernen Griffe ( far la tscharna ). Die Fadenkreuzung beim Zetteln ist vonnöten, um später am Webstuhl die Fäden durch die beiden Kreuzruten richtig ziehen zu können.
Wir waren mehrmals Zeuge des Handzetteins in den bäuerlichen Wohnstuben und bewunderten die Geläufigkeit und Sicherheit der hantierenden Mädchen, als ob sie jeden Tag die Arbeit vor sich nähmen. Aber auch bei Jung und Alt sind diese Eindrücke tief in die Volksseele eingegraben und führten wieder zu zwei alten sursilvanischen Rätselsprüchen. Das rätoromanische Volk hat eine äußerst reiche „ Folklore " oder Oralliteratur an Liedern, Reimen, Rätseln und Märchen. Auf das jugendliche Gemüt mußten das Schnurren, Summen und Hüpfen der sich abhaspelnden zwanzig Zettelspulen Eindruck machen. Der eine Spruch verrät die derbe Männlichkeit: Vegn frars sin ina seif e tuts che seglian e saultan e limi chitschau in pal sul tgil en e sut tgil oIls speuls d' urdir = Zwanzig Brüder, die da springen und hüpfen insgesamt auf einer Hecke und am Hintern doch gepfählt sind, oben und unten und an jeder EckeDie Zettelspulen. Zart weiblich und feinsinnig mutet uns das zweite Rätsel an: Vegn sorettas en vegn combrettas seglian e saultan e sepeglian buco ina Vautra? Us speuls d' urdir = Zwanzig Schwesterchen in gleich viel Kämmerchen, die da springen und hüpfen und immer einander entschlüpfenDie Zettelspulen.
Nach dem Aufhaspeln des Zettelgarnes erfolgt ebenso rasch das Abketten derselben ( far cadeina ). Bald liegt eine elegante lange Garnkette längs des Stuben-bodens. Das Mädchen formt und bindet sie gleich zum „ fasch11 oder Bündel, denn die Übertragung des Zettels auf den Webstuhl läßt oft noch einige Zeit auf sich warten. Der meist verbreitete Oberländer Webstuhl ist der bekannte primitive deutsche „ Länder"-Webstuhl, der teile lad ( Tafelfig. 11 ). Wegen seiner Breite und Tiefe nimmt er die halbe Wohnstube ein. Die meist niederen Zimmer verlangen dieses System. Der Garn- oder Kettenbaum und der entfernte Brust- oder Herzbaum liegen samt Zubehör und der Garnspannung in einer Horizontalebene. Trotzdem beobachten wir in jeder Gemeinde auch den einen und anderen hohen Webstuhl ( Tafelfig. 12 ), den teile autt. Der Garnbaum und der zugehörige gespannte Garnzettel samt Kreuzruten liegen bis zum Streichbaum in der Vertikalebene. Erst dort biegt die Webe ( la teila ) unter dem Streichbaum rechtwinklig in die Horizontalebene nach vorn zu Flachs und Hanf und ihre Verarbeitung im Bündner Oberland.
den Litzen und dem Brustbaum um. Dieses Modell, zum Teil ebenfalls in 50- bis 00jährigen Exemplaren, raubt weniger Raum. Wir finden ihn daher meist in den Schlafkammern aufgestellt, indes die freundliche, geräumige, blumengeschmückte Wohn- und Empfangsstube unbehelligt bleibt. Heute wird diesem Webstuhl, wenn immer möglich, der Vorzug gegeben.
Den Abschluß des Zetteins bringt uns die Übertragung des Garns auf das Webstuhlgestell ( la pétga ). Die Zettlerin löst das „ Garnfasch " und die schlanke, geflochtene Kette, führt die Fäden wohlgeordnet durch das Gitterwerk des schmalen Windkammes ( il risti ), keilt diesen in die Längsnute der Welle des Garnbaumes ( il zubel ), faßt die hölzernen Griffe seitlich an der Welle und windet langsam den Zettel am Garnbaum auf x ). Alsdann ziehen die Arbeiterinnen die parallel geordneten Strangreihen zu den Kreuzruten ( las schinas ) und durch dieselben. Die beiden Ruten kreuzen und scheiden die Fäden auf und ab. Der Leser erinnere sich noch der „ far la tscharnau am Zettelrahmen, wo die Zettlerin mittels ihrer Finger und der Holzgriffe diese Kreuzung bereits eingeleitet hatte.
Von hier ab besitzt die zukünftige Weberin ihre „ teiladas „ Wab ", die Webe. Der spätere Einschußfaden des Schiffchens wird die Garnwebe in Tuch umwandeln. Doch wir sind noch nicht so weit! Die Frauen führen das Fadengerüst weiter durch die „ Augen " der an Zahl wechselnden Schaftlitzen, dann durch den Webekamm zum nahen Brust- oder Herzbaum, vor dem später die Weberin ihren Sitz hat und über den das fertige Tuch gleitet. Das Tuch aber entsteht so, daß die Weberin den Schußfaden des Schiffchens quer durch die Reihen der gespannten Längsfäden stößt und diese durch die Trittbrette wechselnd auf und ab verschiebt. Endlich schlägt sie mit Hülfe der Lade die Einschußfäden eng aneinander. Das Tuch ist fertig. Vom Brustbaum weg verbinden bei der Aufrüstung des Zettels Schnüre das vordere Zettelende abwärts zum Tuchbaum, der quer über den Füßen der Weberin angebracht ist. Er besitzt seitwärts rechts ein Sperrad mit Holzgriffen und Klinke, mit deren Hülfe spannt die Weberin ruckweise das gewobene Tuch auf die Welle2 ).
Damit haben wir den Verlauf des Zetteins und Webens am einfachen Länder-webstuhl wesentlich geschildert. Das Weitere müssen die Bilder dem Leser erläutern ( siehe Fig. 11 und 13 ).
f P. Dr. Karl Hager.
Anhang zum Abschnitt über Faser.
Zusammenfassung der Begriffe und der Verwendung von rèsta, strippa,
schuengia.
1. La rèste1die Reiste, Riste, Feinfaser. Das mühevoll errungene Endergebnis aller Operationen ist die Reiste, die feine, hellgolden glänzende, lange Flachs- und Hanffaser.
Die fertige, jetzt spinnfähige Reiste gibt der Oberländerin das feine linnene Weißzeug für die gesamte Leib- und Bettwäsche, für Tischbedeckung, Handtücher, Servietten und Fenstervorhänge. Sie ist ein wertvolles Stück der Aussteuer der sich verheiratenden Tochter. Wir verweisen im übrigen auf unten: Das Weben.
Der reiche Herbstsegen vom Flachsfeld drängte schon manch braves Mütterchen des Disentiser Talbodens und selbst aus dem südlichen Medelsertal, den einen und anderen seiner feinsten und dicksten poppas de glin zur Marienkirche der Abtei zu tragen. Es legte sie auf den Altar der heiligen Ursula als Weihegeschenk und Dankesgabe an den lieben Gott und Segenspender. Früher war es im flachsreichen Tavetschertal und wohl auch anderwärts Sitte, am „ Armenseelen-Tag " ( 2. November ) der Kirche schöne Flachszöpfe zu opfern. Heute ist der ländlich fromme Brauch in eine Geldspende umgeformt. Schuld daran trägt teils der merkbare Rückgang des Ackerbaues auf Kosten der Viehzucht. Sodann sind seit Jahrzehnten die Behörden bestrebt, sämtliche Naturalabgaben an Kirche, Staat und Genossenschaften durch die bequemere Geldmünze zu ersetzen. Diese erwirbt sich der Bündner Oberländer aus dem Ertrag seiner reichen überschüssigen Viehhabe, die er auf die Herbst- und Frühjahrsmärkte bringt.
2. Die steppe. Der Sursilvane bezeichnet damit nur jenes Abwerg, das aus dem Hechelprozeß hervorgeht.
Das gewonnene Linnen aus der Sluppa-Fatser ist, je nach Qualität, eine Leinwand für alle s. Der abgehärtete Bauer wählt sie hie und da noch zur starken Leib- und Bettwäsche. Die Bäuerinnen nähen ihren Eheherren und Söhnen aus der Äppa-Leinwand die geppas de stuppa, d.h. die Überhemden für Stall und Scheune. Bekannt sind die flachsenen geppas de Breil ( Brigels ) und die hänfenen von Andiast und Flond. Die Tavetscher und andere tragen beim Viehfüttern und Dreschen die Flachs und Hanf und ihre Verarbeitung im Bündner Oberland.
flachsenen tschoss de pervér, Schürzen und Hosenschützer. Von der Oberalp bis Flims, Trins, Tamins beobachteten wir allenthalben die linnenen Überkleider und Schutzgewänder in jedem Nestchen. Dagegen sind die unverwüstlichen Leinenhosen der Buben und die Leinenröcke der Mädchen und Frauen erloschen. Einst jedoch, so erzählen uns die alten Mütterchen, wurden auch diese Linnenkleider getragen, als die Hanf- und Leinkultur noch Gemeingut aller war 1 ). Der Schafwoll-Loden hat sie heute im Oberland ersetzt. Die großen Herden des feinwolligen kleinen Bündnerschafes ätzen und weiden noch überall auf den jedem Rindvieh unzugänglichen und weitschichtigen oberen Alpstaffeln.
Vorzüglich schafft sich die Oberländerin aus der stuppa ihre unentbehrlichen feineren blalis, die großen, festen, weißen Linnentücher für die Arbeiten in Haus, Scheune, Stall und Feld; ebenso die batlinis de fein, d.h. die Heutücher, in denen der Bauer sein Heu und Emd, das Wildheu, die Getreidefrucht, das Stroh, den Flachs und Hanf nach dem Stalle, zu den Kornhisten, zu den Wasserrösten und zur Hofstatt trägt oder führt. Der reichliche Besitz der blahs gibt den Maßstab für Ordnung und Reinlichkeit im ganzen kleinbäuerlichen Betrieb des Sursilvanen. Ein richtiges bündnerisches Hauswesen läßt sich ohne blalis und batlinis de fein gar nicht denken. Die Hausfrau hält sie sauber und blank.
3. La schuengia = Das grobe Abwerg, Schweizerdeutsch der „ Chuder ". Das Wort stammt wohl vom Schweizerdeutschen „ Schwinge ", bedeutet aber nicht das Instrument, sondern den Abfall der Faser, der sich beim ersten spallar oder Schwingen von Flachs und Hanf ergibt. Besonders der Abfall beim spatlar da gries, dem ersten Flachsschwingen, ist bedeutend ( siehe oben ). Die bessere Qualität verwendet die Hausfrau ebenfalls zum Spinnen und zur Herstellung der groben Sackleinwand, grober blahs und batlinis de fein.
Zusammenfassend können wir die Bettleinwand der Sursilvanen als Musterbeispiel der Verwendung der drei Linnengewebe aufstellen. Der Strohsack ( la bisacca ) besteht aus dem scliuengia-Gewehe. Darüber liegt das erste feste Leintuch aus stuppa glin ne conniv. Zwischen das zweite und dritte schlüpft das müde Menschenkind, und beide sind aus der feinfaserigen rèsta, der Reiste, gewoben = la teila de rèsta das feine Linnena'ewebe.
Zweiter Abschnitt. Gewinnung der Samen und des Öls.
17. Kapitel. Die Gewinnung der Hanfsamen. Das Hanföl.
In der zweiten Hälfte des Septembers erfolgt das Raufen des weiblichen Hanfes. Die Bäuerin schneidet mit der Sichel die samenschweren Rispenx ) in die gefaltete Schürze und trocknet sie an der Sonne oder auf dem luftigen Heuboden. Nachher klopft sie mit einem Stecken2 ) die Samen aus den dürren Rispen und reibt den noch haftenden Rest mit den Handflächen aus. Den Ertrag einer kleineren Pflanzung löst sie allein mittels Handreiben. Ein grobmaschiges Sieb von 1 Meter Durchmesser und 5 Zentimeter weiten quadratischen Maschen8 ) sondert die Blatt- und Stilreste vom Samen. Die Handwanne oder häufiger die Kornwindmühle entfernen alsdann die feineren Spreuteile und den tauben Samen. Die letzte Reinigung vollendet ein Feinsieb. Das Riffeln der Hanfrispen fehlt dem Oberlande.
Noch vor wenigen Dezennien war die Gewinnung von Hanföl allgemein üblich. Heute ist sie an einigen Orten erloschen oder sehr eingeschränkt. Die geringe Hanfkultur lohnt das Ölpressen oft nicht mehr. Sie steht damit im starken Gegensatz zu der noch reichlichen Leinölbereitung der Hintertäler und Hochterrassen des Bündner Oberlandes. Einzelne Bäuerinnen ( Ruis ) lassen gelegentlich nach Abzug des Samengutes den überschüssigen Hanfsamen in der Stampfmühle zerreiben, um den Brei als beliebte Beimischung zum Schweinefutter zu verwenden. Manche bereiten aus dem Hanfsamen und den Rispenblättern einen Teeaufguß gegen Wassersucht; oder beide werden geröstet als heiße Kompressen und Auflagen bei Wasserleiden verwendet.
Über die Einschätzung des Hanföles erhalten wir von älteren Bauerfrauen verschieden lautende subjektive Urteile. Alle verwenden es als Speiseöl. Jene, die nur ihr Hanföl kennen, loben es als ein „ bien jeliu zum Kochen. Die Bäuerinnen, die Hanf und Flachs zugleich pflanzen, schelten das Hanföl als „ bitter'1 und von wenig angenehmem Geschmack. Es dient hie und da als Maleröl. Die Bewohner höher gelegener Ortschaften, die keine Torkeln besitzen, schicken ihren Hanf- beziehungsweise Leinsamen zum Keltern in andere Gemeinden. Ihnen fehlt dann die familiäre, feierliche Idylle der Ölgewinnung der Hintertäler Tavetsch, Medels und Disentis. So senden die Leute von Schlans ihren Samenvorrat zu den Torkeln von Darvella, Ringgenberg oder Dardin; die Bewohner von Andest nach Brigels oder Ruis, jene von Fellers nach Schleuis usw. Über die Art und Weise der Ölgewinnung siehe unten: Die Bereitung des Leinöles.
* ) Auch in Frankreich ist das Abschneiden der Samenköpfe üblich. Obwaldner Hanfsamen-rispen = las butschas de sem conniv.
Flachs und Hanf und ihre Verarbeitung im Bündner Oberland,
18. Kapitel. Das Riffeln der Flachskapseln.
Nicht nur in den Längs- und Quertälern des Alpengebietes, sondern in ganz Europa ist das Riffeln der Flachskapseln die verbreitetste Art, den Leinsamen zu gewinnen. Der Bündner Oberländer riffelt unmittelbar nach dem Flachsraufen gleich neben oder auf dem Flachsacker. Je nach Talbodenhöhe und sommerlicher Entwicklung beobachten wir die idyllische Arbeit von der ersten Hälfte des Augusts bis anfangs September. In der flachen Mulde von Sedrun ( 1400 m ) im Tavetsch sehen wir z.B. auf dem sonnigen Plan überall ausgebreitete große Linnen. Auf ihnen steht die hölzerne Riffelbank ( Textfig. 14 ). Sie hat etwa 180-200 cm Länge und 28 cm Breite. An beiden Enden sitzen arbeitende Personen rittlings einander gegenüber. Zwischen ihnen ist auf der Mitte der Bank der Hechelklotz mit dem einreihigen Reffkamm t ) verfestigt. Die schmiedeisernen, kantigen Zähne, meist zwölf an Zahl, sind etwa 20 cm lang und haben am Grunde einen Umfang von vier Zentimeter.
Bald arbeiten Mutter und Tochter, bald ein älteres Ehepaar auf ihrer Dop-pelsitzbank und schlagen in rhythmisch streichender Bewegung abwechselnd je ein Wm^ fi samenschweres Flachsbündel über die eiserne Zahn- reihe ( Tafelfigur 15 ). So Fig. 14. Die Riffelbänke ( réffel ) für Flachs ( Disentis ).
rupfen sie die Kapseln ab, die sich alle auf dem Linnen um die Riffelbank ansammeln2 ). Öfters sehen wir mehrere Riffeln nebeneinander gerückt. Hier helfen sich wieder die freundnachbarlichen cummars und vischins aus: Frauen, Mädchen und Burschen heben, schlagen und streichen, plaudern, schäckern und necken. Der volkstümlichen und beliebten Arbeit entsprang das derbe sursilvanische Takt- und Reimrätsel:
Beppa, reppa si per tscheppa, Scrola tgil e fetga pei?
— Il sborlar il glin.
= Es reibt und streicht am Klotz ( ReffkammEs schüttelt den Ärsch und steift den Fuß? Das Kapselrupfen des Leins.
Immer bindet ein Mann gleich nach dem Riffeln des Leins die kapselbefreiten Flachsbündel zu stattlichen Garben, um sie der Wasserrotte zu überantworten. ( Siehe oben: Die Wasserröste von Flachs und Hanf. ) Auch beim Riffeln entsteht Abfall: teils zerrissene Stengel- und Blatteile, teils ganz abgerupfte Fruchtrispen. Letztere werden sorgfältig abgesondert und auf ein besonderes Linnen verbracht1 ). Sie unterliegen gleich den Haufen reiner Kapseln der Sonnendarre, jedoch gesondert. Schon steht nachmittags die Kornwindmühle am Flachsacker. Sie bläst erst alle Spreu und Flachsblättchen prompt und sorgfältig aus den Kapselhaufen. Früher hatten die emsigen Hausfrauen die liebe Not und schwere Mühe, mittels der Hand wanne diese Arbeit zu verrichten. Das Hand-worfeln 2 ) haben wir vereinzelt noch die letzten Jahre beobachtet.
19. Kapitel. Die Gewinnung der Leinsamen. Die Sonnendarre und Kapselröste.
Die sonnenklaren Septembertage der zentralalpinen Täler bedingen ebenso klare Nächte. Dann läßt der Bauer oft die schweren Kapselbündel auf dem Felde gut zugedeckt liegen. Oder am dämmernden Abend führt das Tavetscher Rindergespann die Bündel auf dem Leiterwagen zur nahen Dorf- und Hofstatt. Sobald am nächsten Morgen die ersten Sonnenstrahlen über die östlichen Bergzinnen blitzen, eilt die Bäuerin wieder auf den Plan. Sie hat sich schon eine windstille Mulde erwählt, wohin die Linnenbündel wandern, 8 —10—20 werden sorgfältig ausgebreitet. Steine beschweren die Ecken und Zipfel der Linnen; oft decken und festigen deren Ränder noch Stäbe und Latten, denn dem sonst so lieben Föhnwind ist doch auch ein „ Schurkenstücklein " zuzutrauen. Die Zähne des Grasrechens verteilen nun sorgfältig alle Kapseln auf dem Linnen. Zu guter Letzt kehrt die Hausfrau den Rechen um und ebnet mit der stumpfen Rückenkante der Zahnreihen alles gut aus. Das Weitere besorgt die sengende Sonne. Sie dörrt tagsüber die Flachskapseln in der lufttrockenen Landschaft gut durch. Schon in den Vormittagsstunden hören wir das leise Knistern und Springen allseitig auf den blendend reflektierenden schimmernden Linnen. Die unermüdliche Bäuerin ist aber längst wieder beim Raufen und Riffeln auf dem Acker oder droben in den Berggütern beim Heuen. Um vier Uhr mittags eilt sie abermals zu ihren sonnengebräunten Flachskapseln. Sie trägt ein mittel- und feinmaschiges Sieb. Erst schüttelt das gröbere, il draig de flucs — Heusamensieb ( mittelmaschig ), die gedörrten und meist aufgesprungenen Kapseln gehörig durch ( Tafelfig. 16 ). Die Samen und ebenso die nicht aufgesprungenen Kapseln fallen durch die Maschen. Die leeren Kapselhülsen aber bleiben oben. Sorgfältig schüttet die Hausfrau diese auf ein besonderes Linnen. Sie ergeben, mit Salz bestreut, ein wahres Leckermahl für die Ziegen und werden in langen Holztrögen oder -rinnen ihnen vorgelegt3 ).
Flachs und Hanf und ihre Verarbeitung im Bündner Oberland.
Das Feinsieb ( il dratg de sem-glin ) sondert endlich die reinen Leinsamen von den noch nicht aufgesprungenen Kapseln. Letztere stammen meist von nicht ganz ausgereiften Früchten und gelangen den folgenden Tag abermals zur Sonnendarre auf die Linnen, bis auch sie ihren schuldigen Tribut abgeben.
Im Jahre 1916 zählten wir an einem schönen Nachmittage nur in der nächsten Umgebung des Dorfes Sedrun ( Tavetsch ) 10 solcher Flachskapsel-„Linnenfelder”, jedes wieder mit zahlreichen Einzellinnen voll golden glänzender Leinkapseln. Manche Hausfrau breitet ihre Flachslinnen statt auf dem offenen Felde an der Hofstatt aus; und zwar längs der sanft ansteigenden Rasen- und Mauerbrücken, die zur Heutenne führen. Besonders die oben erwähnten Abfälle beim Riffeln harren dort der Sonnendarre.
Ausnahmsweise fallen auch sonnenarme oder gar regnerische Herbsttage ein. Das Entsamen der Flachskapseln besorgt dann eine kurze Schwitzkur der Kapseln im festgeschlossenen Linnen über eine oder zwei Nächte. Der beginnende Gährungs-prozeß öffnet die Kapseln. Der sonst so schöne hellbraune Samen wird aber schwärzlich und der Ölertrag qualitativ und quantitativ geringer. Auch Arbeitsüberhäufung drängt die eine und andere Bäuerin zu dieser Art der Samengewinnung, d.h. zur Kapselröste 1 ).
20. Kapitel. Die Bereitung des Leinöles. Seine Verwendung.
Eine der seriösesten und volkstümlichsten Arbeiten der flachsbauenden Bündner Oberländerinnen ist die Bereitung des geschätzten Leinöles. Im Tavetschertale nimmt sie anderthalb Monate in Anspruch, im hinteren Disentiser Talboden etwa drei Wochen, 8 bis 14 Tage in Medels, auf den Plateaus von Obersaxen und Brigels und zerstreut im Ilanzer- und Trunser Talbecken. Von den Morgenstunden bis in die tiefe Mitternacht dauert Tag um Tag die Arbeit in den Stampfmühlen und Öltorkeln der einzelnen Ortschaften. Im Tavetsch kennen wir deren drei, in Disentis drei, in Medels zwei, im Trunser Talbecken, inklusive Dardin, fünf, auf Obersaxen zwei, je eine in Brigels, Ruis, Schleuis, Sagens; die übrigen sind eingegangen.
Familie um Familie wechseln ab und helfen sich aus. Besonders wenn intimere zukünftige Familienbande sich zu knüpfen beginnen, stehen „ spusu und „ spusau und ihre nächsten Angehörigen helfend einander bei. Uralte und ursprünglichste Methoden der Ölgewinnung haben sich in unserem, einst abgeschlossenen, zentralalpinen Längstale erhalten und dazu in verschiedenen Schattierungen des Betriebes. Eigenartig und drollig mutet es an, wenn z.B. im „ Val " bei Cuoz-Disentis die uralten primitiven Flachsfaserpochen, Leinsamenstampfen und die rotierenden Kellen der Ölbratpfannen von vielleicht hundertjähriger Existenz ihren Antrieb heute durch elektrische Kraft erhalten und wenn elektrische Glühlämpchen die dunkeln verstaubten Räume und Keller erhellen. „ Antike und Moderne " vereinigen sich in trauter Harmonie. Wir wollen kurz einige der Betriebsarten berühren.
Erst wird überall der gewonnene Leinsamen zu Mehl, der pasta de sem-glin, gestampft. Eine Stampfbatterie von zwei bis vier Mörsern, die sogenannte pela, zerdrückt den Flachssamen ( Textfig. 17 ). Sie hat große Ähnlichkeit mit der Bleuelpoche der Flachsstengel ( fallun ) und steht oft mit jener verbunden und unter dem f P. Dr. Karl Hager.
gleichen Betrieb. Zu ihrer Konstruktion zeigt sie im Oberland volle Übereinstimmung mit der Batterie der Gerste- und Hirsestampfen und dient abwechselnd dem gleichen Zwecke. Mörser und Stößel, beide von Hartholz, laufen am unteren Ende konisch zu. Am Boden des Mörsers liegt ein eingepaßter Stein. Die Fußsohle des Stößels hat Eisenrillen von starken Kopfnägeln; ein eiserner Ring gibt ihm dienötige Festigkeit.
Aber die Behandlung des Leinsamens in der pela unterscheidet sich von jener der Bereitung der Getreidegrieß-sorten. In jede Mörseröffnung schütten die Frauen und Mädchen etwa zwei Liter trockenen Leinsamen. Die Mörser arbeiten nur vier bis fünf Minuten. Die erste pasta ist fertig, wird herausgenommen und durch ein feinmaschiges Handdrahtsieb tüchtig gerüttelt. Im Val bei Cuoz-Disentis bewegen sich automatisch lange feinmaschige Rüttel unter Wasserbetrieb. Das durchfallende Mehl füllt allmählich große runde Holz-gelten. Der oben bleibende Rest wandert abermals in die Mörser der pela. So poltert die Leinsamenstampfe den langen Tag über, bis der ganze Samenvorrat einer Familie das erste Stampfverfahren durchlaufen hat. Ihm folgt das zweite.Vorerst gießen die Frauen auf je eine curtauna ( Viertel zu 71/ì Liter ) Lein- samenmehl eine Schüssel voll Wasser, kneten die Masse gut durch und fördern sie wieder in die Mörser. Jetzt bedarf es guter Überwachung der Teigmasse. Mit einer Holzspachtel wehrt die Arbeiterin dem Zusammenballen des Breies, und mit einer Handbürste löst sie den am Stößelende haftenden Mehlbrei. In 15 Minuten ist auch diese Knetarbeit jeweils im Mörser vollendet. Dem zweiten Knetgang folgt das zweite Sieben. Das neue Drahtnetz muß grob-maschig sein ( etwa mit ein Zentimeter weiten Öffnung ). Die gestampfte pasta bedarf nur noch der Auflockerung und geht insgesamt durch das Rüttelsieb. Lange Holztröge nehmen den Leisamenbrei auf. Die braune Masse duftet aromatisch; sie ist zum Ölpressen vorbereitet1 ). Alle diese Manipulationen nehmen die emsigen x ) Siehe Note auf folgender Seite.
Flachs und Hanf und ihre Verarbeitung im Bündner Oberland.
Frauen gleichzeitig vor. Es sind ja ihrer viele beisammen; es sind wieder die befreundeten cummars und vischinas. Sie müssen sich auch sputen, denn das endgültige Ölpressenfindet in der Regel erst in der Nacht statt, wenigstens im Tavetschertale. Im Disentiser Talboden und auf Obersaxen beobachten wir das Torkeln heute ebenso tagsüber. Das nächtliche Torkeln, ist ein Erbstück aus jener uralten Zeit, wo das Ölpressen einzig durch Hebelvorrichtungen stattfand, ohne Benützung der bequemeren und leichteren Handhabung der Schraubentorkeln. Wir finden heute noch beide; die ersteren sind aber am Erlöschen. Das Frauenvolk erhält die nötige Männerkraft zur Führung der Hebelpresse erst des Abends, wenn die „ Herren der Schöpfung " von Wald, Wiese und Stallung nach Hause kehren: Alsdann verlockt zur seriösen Nachtarbeit von jeher die einzigartige Volksidylle. Noch heute beschließt nach Mitternacht das Torkeln der beliebte puschegn, das Liebesmahl mit nachfolgendem Tänzchen, Scherz und Humor, wenn das passende Jungvolk sich zusammenfindet.
Abends acht Uhr betreten wir einen kellerartigen hohen Raum, wo das Torkeln eben seinen Anfang genommen hat ( Tafelfig. 18 ). Vorn in einer Ecke des gespenstig erleuchteten Raumes sitzt ein Mädchen am flackernden Feuerherd und führt eine Holzspachtel neben der großen flachen Bratpfanne, indes eine hohe Wellenstange senkrecht über der Bratpfanne sich dreht. Die Welle hat am unteren Ende eine horizontal laufende eiserne Spachtel, welche die braune, dampfende Samenpaste in der Pfanne wälzt und kehrt. Das Mädchen kontrolliert. Alle 5-10 Minuten, je nach dem Brand im Herd, wird die Paste der Pfanne enthoben und abermals eine curtauna voll Leinsamenmehl eingelegt. Das Anrösten2 ) der Paste bewirkt, daß die heiße Masse das Öl unter dem Drucke der Torkel besser abgibt.
Ist die kurze Röstzeit vorbei, so spannen zwei Personen ein kleines, festes Linnen an seinen Zipfeln. Die dampfende Röstmasse wird darüber 3 ) gegossen, das Linnen eiligst zum Wulst gedreht und in den Torkelmund geschoben ( Tafelfig. 20 ). Der Kelterpfropfen ( il tscìièp ) wird aufgesetzt und der Hebel oder die Schraube in Tätigkeit versetzt. Man steigert den Druck so lange, bis das Öl den seitlichen Kelter-öffnungen zu entströmen beginnt, läßt erst einige Minuten abfließen und erhöht nach kleinen Zwischenräumen den Druck. Im Inneren der massigen, hölzernen Torkel liegt ein festes durchlöchertes Brettstück, das den Ölkuchen oben behält und die Poren der Torkel vor dem Verstopfen schützt. Jeder Torkelgang ( eine voll gestrichene curtauna Leinsamenmehl ) ergibt etwa 112 Liter reines Öl. Der zurückbleibende gewonnene Ölkuchen wiegt 2l/i bis 3 Kilogramm. Die einzelnen Familien bereiten sich im ersten Torkelgang ein besonderes Feinöl. Die Samenpaste dazu unterliegt nicht dem Röstprozeß am Feuerherd, sondern wird gleich der Ölpresse übergeben.
Zu vorhergehender Seite ) Tagsüber besuchen die Kinder öfters ihre an der Samen-stampfe arbeitenden Mütter und erbetteln sich die Leinmehlpaste zum Schlecken und Naschen.
Auch der Verfasser erinnert sich noch der Öltorkel aus seiner gasterländischen Heimat, wo einst Baumnüsse gekeltert wurden und wir Buben verlangenden Blickes das wunderliche Instrument und die duftenden Nußkuchen umstanden. Allein die Nußbäume sind längst verschwunden und zu Schäften des mörderischen Gewehres verarbeitet. Wo einst die alte Öltorkel stand, kämpfte später eine Si-hifflistickmaschine um ihre Existenz.
Das Ergebnis ist das jeli purschal, das „ jungfräuliche Öl "; es gilt als hochgeschätzte innere Medizin für Menschen und Tiere und wieder als linderndes Mittel bei Wunden.
Das erste Produkt des Öldruckes verkostet in der Kegel jedes Glied der arbeitenden Familie. Bevor das nachmitternächtliche wohlverdiente Festmahl, der ,,puschengu, seinen Anfang nimmt, reicht man ein Gläschen des gewonnenen Schatzes in der Runde zum Nippen1 ).
Bei unseren Nachfragen über Bevorzugung des Leinöles bei Bereitung von besonderen Fettspeisen machten wir die Erfahrung, daß Verwendung und Ansichten so oft auseinandergehen, als wir Hausfrauen prüften. Der individuelle Geschmack ist überall wegleitend. Alle aber sind voll des Lobes über ihr selbst gezogenes Speiseöl, das jeli de sem-glin.
Auch das Leinöl hat einen schwach bitteren Geschmack, an den man sich aber schnell gewöhnt wie der butteressende Mitteleuropäer an das südländische Olivenöl. Nach vielen Anfragen vom hinteren Tavetscher Talboden talwärts bis nach Dardin bevorzugen die Einheimischen die mit Leinöl angerichteten Fettspeisen und ziehen es selbst ihrer feinen Alpenbutter vor. Sie stellen häufig Fettmischungen mit Rinder-, Schaf-, Ziegen- und Schweineschmalz her, das sogenannte piaun d'jeli. Vor dem jetzigen Kriege wurde das Leinöl oft als teuer bezahltes Maleröl wegen seines Hoch-glanzes verwendet. Vor der Einführung des Petrols diente es neben der Butterlampe ebenso zu Leuchtzwecken.
Den Ölkuchen oder das Ölbrot ( paun d'jeli ) gebrauchen die Bauern zur Kälber-und Schweinemast, dann als Medizin für krankes Rindvieh. Die ^eto-Stampfe zerdrückt dann öfters die hart gepreßten Ölbrote abermals zu Mehl, zur frina de paun d'jeli, um es bequemer zu verwenden. Die Bäuerinnen kochen das Mehl mit Wasser in einer Pfanne auf und verabreichen es so den Tieren. Seltener rühren sie das Mehl nur mit kaltem Wasser an.
Die meisten der heute im Betrieb stehenden Stampfmühlen und Öltorkeln sind Privateigentum. Die Benützung des Triebwerkes von Seiten der einzelnen Familien, die ja immer selbst der Arbeit obliegen, verlangt eine Bezahlung und zum Teil auch eine Entlohnung. Denn ein Familienglied des Torkelbesitzers überwacht die Arbeit. Die Entschädigungstaxen sind örtlich verschieden. In Gonda-Sedrun ( Tavetsch ) z.B. gibt die Familie dem Torkeleigentümer auf je fünf Ölbrote ( jedes entspricht einem Druck ) ein Brot; auf je sechs Brote das Öl von einem Brot, aber ohne Brot; auf 12 Ölbrote je ein Brot und das Öl von einem Brot. Einfacher macht es der Besitzer im Val bei Cuoz-Disentis; er entnimmt als Löhnung das elfte Brot und dessen Öl. Überall sind es Naturalabgaben.
Wir kommen noch kurz auf die Konstruktion der Öltorkeln zurück. Der hölzerne Torkelstock ( Kelter ) hat sich trotz der Verbesserungen der Druckvorrichtungen in seiner primitivsten ursprünglichen Einfachheit erhalten. Manche dürften ein Betriebsalter von über 100 Jahren besitzen ( Tafelfig. 19 ).
Als Druckvorrichtungen beobachten wir zwei Typen: die Hebelpresse und die Schraube. Der Hebeltyp ist der ursprünglichste und war noch vor fünf Dezennien allgemein im Gebrauch, besonders im Tavetscher und Disentiser Talboden. Heute finden wir nur noch zwei abweichende Relikte vor, in der Cavorgia ( Tavetsch ) Flachs und Hanf und ihre Verarbeitung im Bündner Oberland.
und im „ Tobel " bei Meierhof ( Obersaxen ). Der Cavorgiatyp war der überall übliche ( Tafelfig. 19 ).
Das eine Ende eines schweren, 4-5 m langen Balkens wird zwischen den Kelterpfropfen und ein starkes Querholz eingeschoben und noch durch ein Holzstück verkeilt. Längs des „ Baumes " ( Balkens ) stellen sich eine Reihe Männer oder Burschen und drücken auf Kommando mit den Händen den Balken nieder, bis das 01 zu fließen beginnt. Am äußeren Balkenende sitzen dann die Burschen auf, treiben nebenbei allerlei Schabernack und finden noch Zeit, das Weibervolk zu necken. Hört das Öl zu fließen auf, so schieben sie am äußeren Ende des langen Balkens eine Querstange in eine quadratische Öffnung an der Wand des Arbeitsraumes und pressen durch das Niederdrücken dieses Querhebels auf den Längsbalken den letzten Ölrest aus.
Örtlich angepaßt und originell ist der Hebeltyp im „ Tobel " bei Meierhof ( Tafelfig. 21 u. 22 ). Der Torkelraum dient das Jahr über als offener Holzschuppen, lehnt sich links an einen Stall und rückwärts an eine glatte Felswand; die rechte und die Stirnseite sind offen. Stützbalken tragen das freie Giebeldach, und Hängebirken senken vom oberen Felsenrande ihre Zweige darüber. Naht die Zeit des Ölpressens ( Mitte Oktober bis Mitte November ), so räumt man den Schuppen aus und rückt den üblichen hölzernen Keltertrog nach hinten an die Felswand. In der Höhenlage des Kel- terpfropfens ist in den Felsen eine quadratische Öffnung eingemeißelt, in welche das eine Ende eines mächtigen, schweren, 6 m langen Hebelbaumes eingeschoben werden kann. Das vordere Ende des Baumes hängt und schwebt hoch unter dem Giebeldach an einem Dreiangel mit Haspelvorrichtung.
Sobald die Kelter mit der gerösteten Breimasse beschickt und der Pfropfen eingesetzt ist, so schiebt ein starker Mann das vordere Ende des Hebelbaumes in die Felsöffnung über dem Kelterpfropfen und haspelt alsdann den schweren Baum langsam zur Tiefe. Das Eigengewicht des sinkenden Balkens preßt bereits das meiste Öl aus, bis er die Horizontallage erreicht hat. Hernach befestigt der Arbeiter mittels einer eisernen Kette einen mehrere Zentner schweren Stein am äußeren Ende des Balkens. Der Stein wurde zu diesem Zwecke einst aus dem nahen Waldbach hergerollt. Mit Riesenkraft haspelt jetzt der Mann den Steinklotz zum Balkenende empor. Stein und Balken senken sich langsam zur Erde, und der letzte Ölrest wird gründlich aus dem Ölkuchen getrieben.
Jahrbuch des Schweizer Alpenclub. 53. Jahrg.
12 f P. Dr. Karl Hager.
Unser Auge schaut bei dieser Arbeit in der bereits verschneiten wilden Wald-und Felsschlucht, beim Anblick der Hünengestalt des Obersaxer Bauern und seiner primitiven Hilfsmittel, weit zurück in die Urzeit der alten Räter auf 2000-3000 Jahre. Doch die heimelige Waldmühle nebst Wohnung am rauschenden Wildbache, die Bleuelpoche des Flachses und die Stampfmühle des Leinsamens im dunkeln Kellerraume in unserem Rücken tragen uns gleich wieder vorwärts ins 15. Jahrhundert. Das elektrische Glühlämpchen der Wohnstube versetzt uns vollends in das 20. Jahrhundert. Im'November 1916 bannten wir diese Idylle auf die photographische Platte.
Auch manche der Seh rauben torkeln haben ein ehrwürdiges Alter. Ihre massigen Gewinde sind von hartem Holz. Die Öffnungen für die einzuführenden Drehstangen sind heute schwer „ ausgelaufen ", weil kurzweg eiserne Stemmeisen eingeschoben werden, um die Schrauben zu drehen. Die älteste Schraubentorkel fanden wir mitten im Dorfe Truns ( Textfig. 23 ). Ihrer wird urkundlich bereits im Jahre 1817 gedacht. Heute steht dieses Stück außer Gebrauch der ursprünglichen Verwendung. Sie leistet noch Dienste zum Pressen der Hollunder- und der Himbeeren. Wir begegnen der hölzernen Schraubentorkel in manchem stillen verborgenen Geschäfte, meist aber ist sie durch eine moderne eiserne Schraube verdrängt.
Wir treffen ferner Öltorkeln, die Korporationseigentum der Weiler sind: so in der Cavorgia-Tavetscli und in Disla-Disentis. In beiden Dörfchen sind sie in einem Vorzimmer des kleinen Ortsschulhauses untergebracht und mit Feuerherd eingerichtet. Als wir im Jahre 1916 jene von Disia einer längeren Photo-Zeitaufnahme unterwarfen, erklärte eben der ehrwürdige alte Lehrer seinen kleinen romanischen Buben und Mädchen das schwierige Fürwort während der deutschen Unterrichtsstunde.